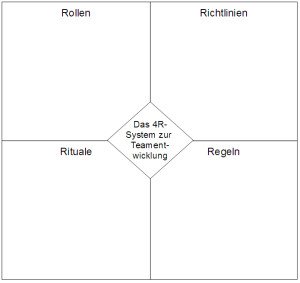Friedrich Nietzsche unterschied Apollinische von Dionysischen Gesellschaften. Zwar gibt es keine Gesellschaft, die ausschließlich das eine verfolgt. Dennoch sah er in der damaligen Gesellschaft eindeutig das Apollinische in der Oberhand. Die heutige Gesellschaft wäre aus seiner Sicht mit Sicherheit noch (bitte Steigerung einfügen) schlimmer.
Das Apollinische
Das Apollinische ist für Nietzsche die Sprache, der Intellekt, die Wissenschaft, die Industrie, der Fortschritt, der Staat, das Maskenhafte am Menschen, die Rollen, die er spielt, gesellschaftliche Regeln, letztlich alles, was echtes Leben unterdrückt. Man könnte sagen alles Bürgerliche, sogar oder v.a. die Religion, die zwar einen Zugang zum Dionysischen schaffen, diesen jedoch durch starre Regeln wieder einschränkt.
Das Dionysische
Das Dionysische ist für Nietzsche alles, was den Menschen lebendig macht: Liebe, Kampf, Wut, Trauer, Leiden, Aufopferung und Spannung. Das Dionysische macht das wahre Leben aus, ist jedoch oft so unerträglich intensiv, dass wir das Apollinische als Vermittler brauchen, um uns nicht darin zu verlieren. Die Sprache jedoch kann das Dionysische niemals zu 100% vermittelt. Darin besteht das Dilemma des Dionysischen: Wir streben es an, uns lebendig zu fühlen und gehen ohne eine Apollinische Vermittlung darin unter (siehe auch: Die 7 Todsünden). Aus Genuss wird Sucht und Völlerei. Aus Liebe wird Eifersucht. Aus Nervenkitzel wird Todesangst. Aus Kampf wird Krieg. Die Apollinische Vermittlung jedoch nimmt dem Leben seine Nähe und Lebendigkeit.
Kunst und Kultur
Das einzige, was dem Dionysischen in unserer Zeit nahe kommt, ist die Kunst, v.a. die Musik (Nietzsche war in jungen Jahren ein großer Anhänger von Wagner). Nur in der Musik findet ein unmittelbarer Kontakt zu den großen Gefühlen und Mythen den Menschen statt, findet er Einklang mit sich, allen anderen Menschen, Ralph Waldo Emmersons Weltenseele, dem Kosmos, Gott, mit seiner Vergangenheit und Zukunft. Kunst und Kultur als universale Weltensprache ist die einzige Sprache, die alle Menschen verstehen und daher die Macht hat, Menschen aller Herkunft, Hautfarbe und Sprache zu verbinden.
Nietzsche Revisited 2017
Diese Unterscheidung erscheint mir auch heute noch brennend aktuell. Was sind Hasskommentare anderes als der Wunsch nach Provokation, der Wunsch, in den Kampf zu ziehen, der Wunsch durch die Verletzung des Gegners eine echte Reaktion zu provozieren, dem ansonsten (vielleicht) tristen Leben etwas Würze zu verleihen? Die Provokationen, die wir auf Deutschlands Straßen als auch im Internet seit einigen Jahren miterleben, erscheinen wenig sinnvoll. Sicherlich, es werden neue Themen platziert, rechtes Gedankengut wird hoffähig. Doch ansonsten erscheint es seltsam, dass Menschen, die i.d.R. satt genug sein müssten dennoch demonstrieren. Oft sind es auch nicht die Ärmsten der Armen, die auf die Straße gehen. Im Gegenteil handelt es sich um bunt gemischte Gruppen in Dresden und anderswo. Gut situiert, studiert, jung, alt, arm, reich. Das Märchen vom rechten Lumpenproletariat können wir uns abschminken. Umso dringlicher stellt sich die Frage: Was wollen diese Menschen? Wurden sie vergessen? Die fortschreitende Digitalisierung, Flexibilisierung, TTIP, Globalisierung und Flüchtlingskrise können die Auslöser einer tieferliegenden Frustration sein. Können Sie jedoch deren Hintergründe erklären? Warum reagieren Menschen mit Wut und Hass auf eine Frau, deren größtes Verbrechen es ist, nichts zu tun und ihr zweitgrößtes das zu tun, was gerade angesagt ist? Wenn Sie mich fragen: Frau Merkel langweilt mich. War da sonst noch was? Ich hab in mir nachgesehen und nichts gefunden.
Was jedoch, wenn die Volksseele nach etwas anderem dürstet (wer Nietzsche liest, verfällt bisweilen in diesen romantischen Duktus)? Was, wenn Ihnen die Mythen fehlen? Das Dionysische? Wenn Sie sich im Spiegel stets wiederkehrender Nachrichten einfach nur langweilen? Was ist, wenn Sie das Maskenhafte satt haben? Das Spiel der Politiker, die nur noch sagen, was sie sagen dürfen. Andernfalls würde man sie innerhalb von fünf Minuten medial lynchen. Das Spiel der Interviewer, von denen nur wenige bis an die Schmerzgrenze gehen. Die oft auch unsauber recherchieren. Der Konkurrenz- und Zeitdruck lässt es kaum noch zu. Das Spiel der Lehrer, die Angst vor den Eltern haben. Das Spiel der Führungskräfte, die Angst vor dem Betriebsrat haben. Eltern, die ihre Kinder sich selbst und den Medien überlassen: Laissez Faire 2.0. Haben die Eltern vor ihren Kindern Angst? Keine klaren Worte. Kein Reißen, Zerren, Beben oder Strecken für die gute Sache, was auch immer das sein mag. Das Leiden und Kämpfen spielt sich stattdessen stellvertretend im Kino und vor den heimischen Fernsehern ab. Wer braucht Auseinandersetzungen, wenn es Star Wars gibt und sich der Kabarettist in der Anstalt so herrlich aufregt? Das reicht doch für mich mit, oder etwa nicht?
Die Wahl der Waffen lässt sich kritisieren. Dennoch ist es meines Erachtens die Überlegung wert, worin die tieferen Gründe unserer aktuellen Lage bestehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Schlüssel auf diese Frage Lebendigkeit heisst.
Das Amfortas-Syndrom besagt, dass wir uns oft nicht trauen, die richtigen Fragen zu stellen, weil wir vor den Antworten Angst haben. Was würde jedoch passieren, würden wir unser Gegenüber, gerne auch einen politischen Gegner, fragen: Wann fühlst du dich lebendig? Wofür lebst du? Wofür arbeitest du? Was willst du deinen Kindern beibringen? Was soll die Nachwelt über dich erzählen? Wofür schlägt dein Herz?
Zuvor sollten wir diese Fragen jedoch für uns selbst klären.
Vielleicht kommen wir damit der Wahrheit, die nicht irgendwo da draußen ist, sondern immer dazwischen liegt, ein Stückchen näher als mit den üblichen Dafür-Dagegen-Spielchen.
 Michael Hübler
Michael Hübler