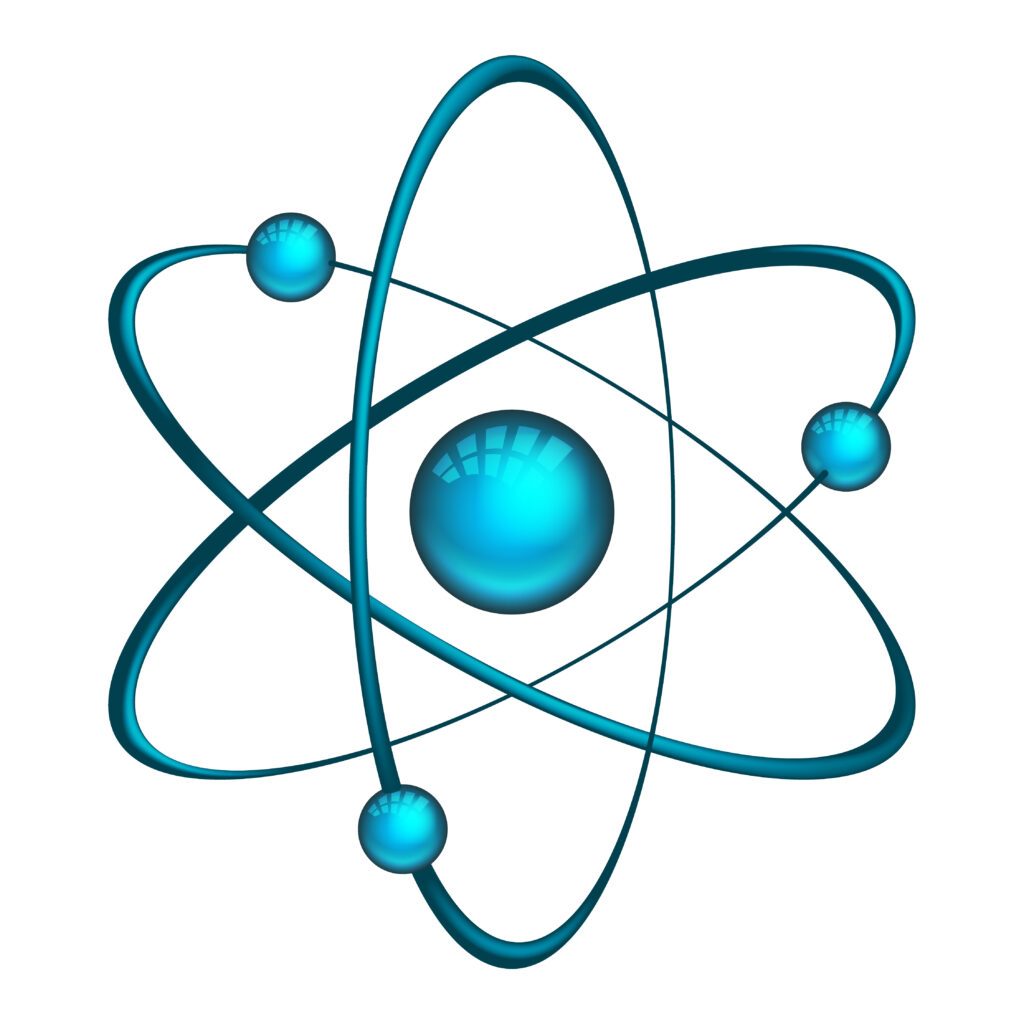- Solidarität gleicht Handicaps aus: Vor 20 Millionen Jahren hatten Schimpansen, Bonobos und Gorillas gegenüber ihren Vorfahren einen großen Nachteil: Ihnen fehlten scharfe Eckzähne und Klauen als körperliche Werkzeuge zur Verteidigung gegenüber Feinden. Dieses Handicap machte den sozialen Zusammenhalt untereinander notwendig.
- Altruismus ist natürlicher als Egoismus: Anderen zu helfen ist natürlicher als uns gegen andere durchzusetzen. Dies zeigt sich alleine schon an diversen Studien mit Kleinkindern, die nicht lange nachdenken, ob sie einem hilfsbedürftigen Forscher helfen wollen oder nicht. Wer anderen nicht hilft, ist dazu aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage. Entweder er fühlt sich zu schwach. Oder er lebt in einem sehr individualistischen System, in dem Helfen als nicht sinnvoll erachtet wird, weil die Menschen sich selbst aus ihrem Elend befreien sollten. Oder aber er wurde traumatisiert. Ein Beispiel dafür sind Migranten, die besonders laut gegen nachziehende Migranten wettern. Sie haben es geschafft, wissen jedoch, wie schwer es war. Beobachten sie nun Neuankömmlinge fällt es ihnen schwer, sich in deren Lage zu versetzen, ohne retraumatisiert zu werden.
- Verbundenheit entsteht durch Ziele: Menschen in einem Bus sind idR. nicht miteinander verbunden. Erst durch einen Ausflug oder einen Unfall entsteht Verbundenheit durch ein gemeinsames Ziel und gegenseitige Abhängigkeiten.
- Disstress + Definition einer guten versus schlechten Gruppe = Tribalismus: Stress führt nicht automatisch zu Egoismus. Meist führt Stress dazu, sich gegenseitig zu helfen. Erst die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Subgruppen fördert Spaltungen und selektiven Altruismus. Umso wichtiger sind in Organisationen mit mehreren Subgruppen Organisationsziele, die auch die Subgruppen miteinander verbinden.
- Dauerhafte Verbindungen lassen Gehirnzellen wachsen: Bei Paaren fördert Monogamie die Entwicklung des Gehirns, sofern sie sich im Rahmen ihrer gegenseitigen Abhängigkeit stetigen Anpassungsprozessen aussetzen. Sie achten dann darauf, wie es ihrem Gegenüber geht, passen sich an und lernen voneinander. Bei Polygamie entwickelt sich das Gehirn (meistens) weniger stark, weil bei Schwierigkeiten Partner*innen schneller gewechselt werden. Dadurch finden weniger Anpassungsprozesse und ein gegenseitiges Lernen statt. Stattdessen orientiert sich der Mensch stärker an seinen eigenen, bereits vorhandenen Eigenschaften, Vorlieben und Kommunikationsmustern.
- Kleine Gruppen ermöglichen individuellere Verbindungen: In kleinen Gruppen werden Menschen stärker als Individuen wahrgenommen. Je größer die Gruppe ist, desto wichtiger werden Abgrenzungen durch Geschlecht, Meinungen, Eigenschaften, Fähigkeiten oder Auftreten.
- Stufen der Empathie: Es gibt drei Stufen der Empathie: Mitgefühl, Besorgnis und Perspektivenübernahme.
- Wer zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, ist unempathisch: Wir helfen anderen Menschen, wenn wir deren Emotionen in einer belastenden Situation nachempfinden können (Mitgefühl). Stellen wir uns jedoch vor, wie es uns selbst in dieser Situation ginge, hindert uns das an einer Hilfe. Wir sind dann zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Der Satz „Wie würde es dir gehen, wenn du an meiner Stelle wärst?“ könnte daher kontraproduktiv sein. Sinnvoller wäre: „Kannst du dir vorstellen, was ich dabei empfinde?“ (Mitgefühl) oder „Versuch bitte die Situation mit meinen Augen zu sehen.“ (Perspektivenübernahme)
- Synchronisierte Gehirne: Arbeiten Menschen an etwas Gemeinsamem, synchronisieren sich ihre Gehirne. Das gleiche gilt für gemeinsames Meditieren. Oder wenn sie als Paar bezeichnet werden, selbst wenn sie noch kein Paar sind.
- Verbindungen fördern mit Gesprächsstoff: Neben den üblichen Möglichkeiten Verbindungen zu fördern (Austausch, gemeinsame Aktivitäten), gibt es in Organisationen die Variante, für Gesprächsstoff zu sorgen, indem jemandem im Team heimlich ein Geschenk gemacht wird, einmal im Monat für das gesamte Team von einem unbekannten, guten Geist Brezeln hingestellt werden, jemand eine Dankbarkeitskarte ohne Absender bekommt oder derselbe Geist am Kaffeeautomaten für die nächste Person bezahlt und eine Karte hinterlässt, auf der steht: „Ihr Getränk wurde bereits bezahlt. Es wäre schön, wenn Sie für die nächste Person bezahlen würden, um diese Nettikette nicht abreißen zu lassen. Danke“
Damit ließe sich Verbundenheit auf folgende Formel reduzieren:
Verbundenheit = Gemeinsames (positives oder negatives) Ziel + Abhängigkeiten (Kompetenzen, Erfahrungen, Wissen, Rollen, Verantwortungsteilung, Tugenden) + Raum und Zeit für Austausch – Persönliche Traumatisierungen
Literatur: Lynne McTaggart: The Bond – Über die Wissenschaft der Verbundenheit (2017)
 Michael Hübler
Michael Hübler