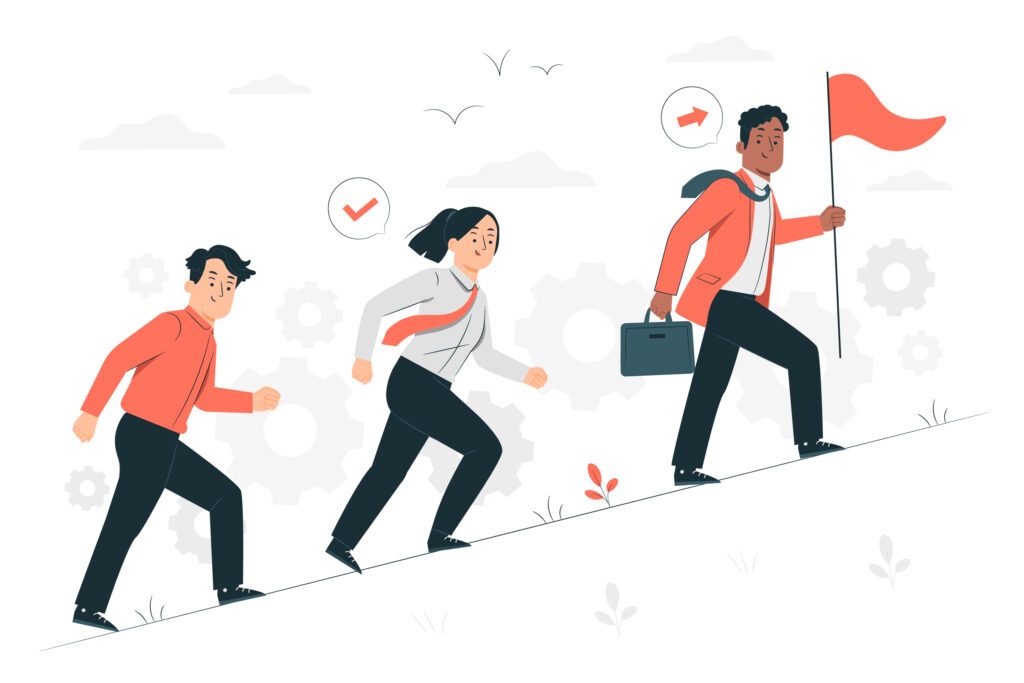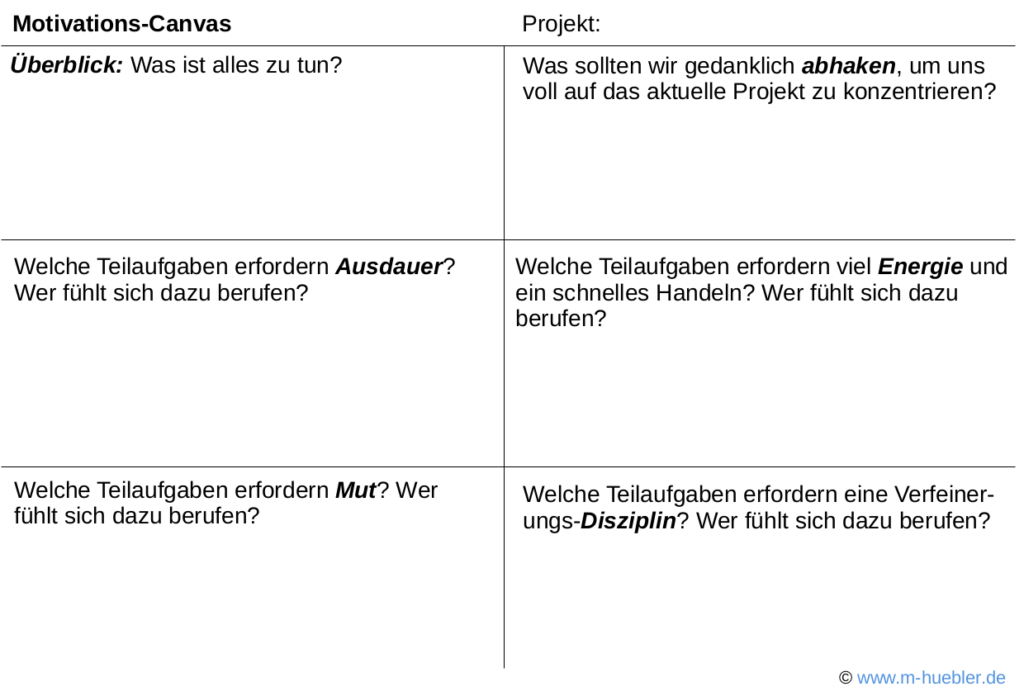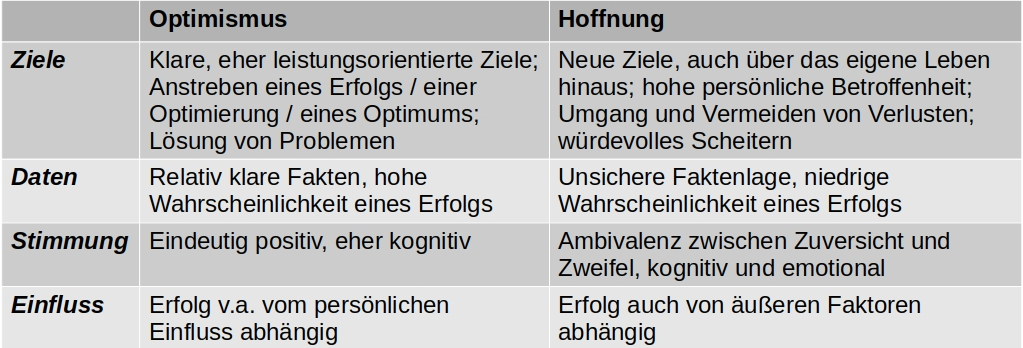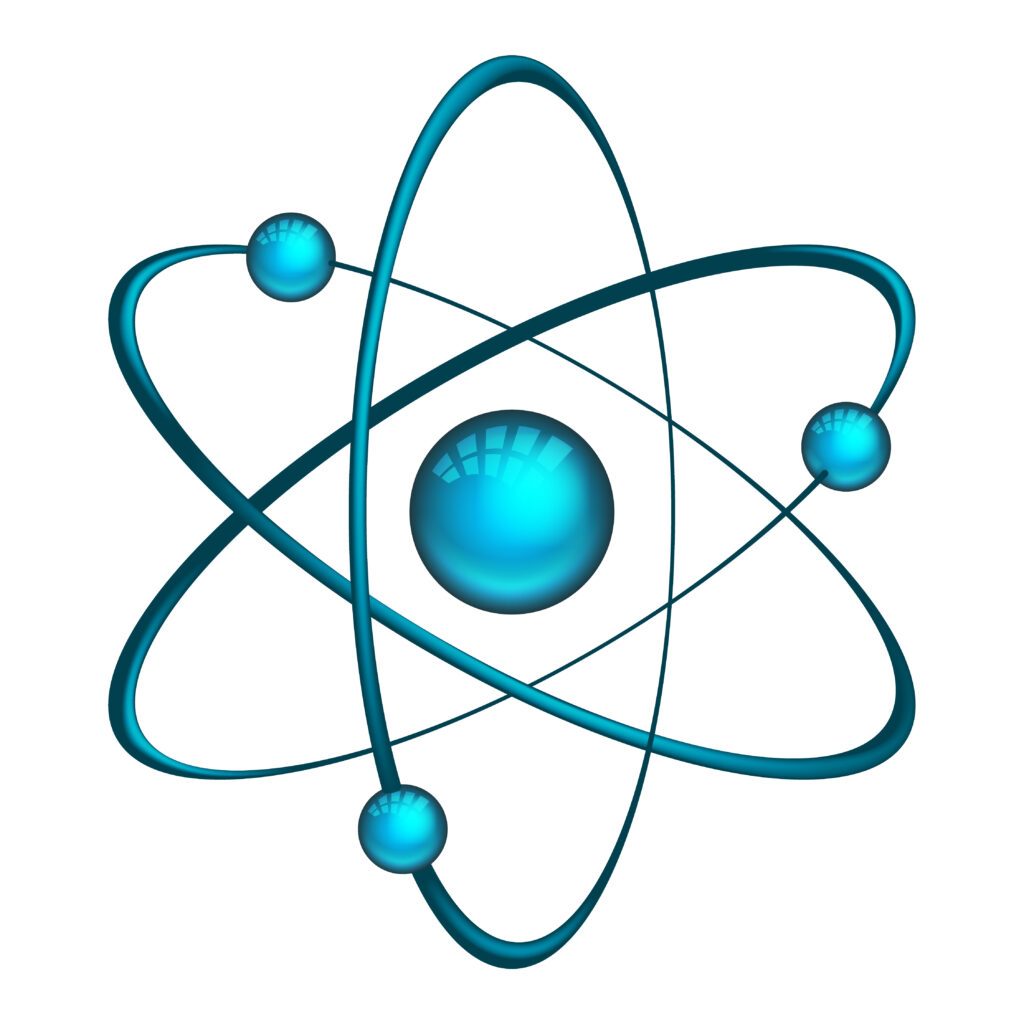Stellen wir uns vor, eine kleines Team von etwa 10 Personen kommuniziert viel über einen virtuellen Messenger-Dienst, wie es heutzutage üblich ist, weil sich ansonsten selten alle zusammen in Präsenz treffen. Eines Tages ärgert sich Person A über Person B. Es handelt sich nicht um einen vorübergehenden Ärger, der immer mal wieder stattfindet und schnell wieder verraucht. Nein. Person B ist neu im Team und Person A hat das Gefühl, Person B würde ihr seine Rolle streitig machen. Person A ist zwar schon lange im Team und hat auch einige Fürsprecher*innen. Person B jedoch kommuniziert klarer, ist cleverer und strahlt eine natürliche Dominanz aus, die Person A fehlt. Person B könnte damit zu einer echten Bedrohung für Person A werden. Was also tun?
Da Person A nicht gerne kommuniziert, erstellt sie eine neue Gruppe in dem Messenger-Dienst und lädt drei weitere Teammitglieder ein, um sich über Person B auszulassen, die freilich nicht eingeladen wurde.
Vermutlich werden Sie jetzt alle sagen: Geht gar nicht! Und natürlich geht das auch nicht, selbst wenn einige dort draußen ähnliches in Tuschelgruppen in Präsenz praktizieren. Die einzig sinnvolle Antwort auf eine Einladung in eine solche Gruppe lautet: Schreiben, dass das nicht geht und wieder austreten.
Dennoch verdeutlicht der Fall, wo wir beginnen sollten, wenn wir die Welt zu einem besseren Ort machen wollen: Bei Prinzipien, die direkt im Alltag wirken. Und das Prinzip hinter diesem Fall lautet: Über Nicht-Anwesende wird maximal positiv gesprochen, aber auf keinen Fall gelästert. Denn ehrgeizige Werte, bspw. „Wir sollten gut miteinander umgehen“ sind oftmals zu schwammig und zu weit weg im Alltag.
In der Klima-Bewegung gibt es bereits seit Jahrzehnten die Empfehlung in Mikrozielen zu denken: Würden wir alle ab morgen nur noch Joghurt im Glas kaufen, wäre das eine Revolution. Denn was nutzen uns hochtrabende Klimaziele, wenn es im Alltag nicht funktioniert? Genauso könnten wir kommunikativ mit Prinzipien verfahren.
Ein guter Start dazu ist seit Jahrhunderten die Bergpredigt bzw. der kategorische Imperativ von Kant: Handle stets so, dass dein Handeln gleichzeitig als allgemeine Regel gilt. In einer erweiterten Form hat der sehr lesenswerte, bekannteste deutsche Humanist Michael Schmidt-Salomon 10 Angebote formuliert, die sich hier nachlesen lassen (externer Link): https://www.schmidt-salomon.de/bruno/human/manangebote.htm
Ein Auszug:
- Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
- Nutze Argumente anstatt zu moralisieren.
- Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht abweisen solltest.
- Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher. Zweifle aber auch am Zweifel. Selbst wenn unser Wissen stets begrenzt und vorläufig ist, solltest du entschieden für das eintreten, von dem du überzeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für bessere Argumente, denn nur so wird es dir gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dogmatismus und Beliebigkeit zu meistern.
- Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach allen Seiten hin informierst, bevor du eine Entscheidung triffst.
- Stelle dein Leben in den Dienst einer größeren Sache, um die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort zu machen.
Ergänzt werden können diese Angebote durch die Maxime, jemanden nicht in seiner Selbstachtung zu beschädigen bzw. seine Würde zu achten (siehe extenen Link https://www.ardmediathek.de/video/suite-der-kulturtalk-mit-serdar-somuncu/haben-wir-eine-gute-umgangskultur-julian-nida-ruemelin/rbb/Y3JpZDovL3JiYl85M2Q1YjNlNi00OTMwLTQzNmItOWM1Ny05NzRiZGM3ZGQ0ODZfcHVibGljYXRpb24).
Doch wenn ich das lese, pendelt mein Gehirn – ähnlich wie bei Werten – irgendwo zwischen „banal“ und „logisch“, als müsste es die einfachste Sache der Welt sein, so zu handeln, weshalb wir uns fragen sollten: Warum läuft dann so vieles schief in Organisationen und auf dieser Welt? Ganz einfach, weil große Ziele oder Werte in ihrer Vereinfachung meist einleuchtend klingen und es gerade deshalb auf die Umsetzung ankommt. Denn dort gibt es Befindlichkeiten, Unfähigkeiten und Interessenkonflikte.
Verdeutlicht an unserem Einstiegsbeispiel:
- Befindlichkeiten: Wer sich ärgert, sehnt sich nach einer schnellen Unterstützung.
- Unfähigkeiten: Wer sich nicht imstande fühlt, sich einer Diskussion mit einer von ihm überlegenen Person zu stellen, greift schneller zu unlauteren Mitteln.
- Interessenkonflikte: Wer sowohl Person A als auch B versteht, befindet sich in einem Dilemma.
Es bleibt uns folglich nicht nur nichts anderes übrig, als uns jederzeit selbst zu hinterfragen, ob unser Handeln als allgemeine ethische Maxime gelten kann. Wir müssen uns auch emanzipiert und selbstverantwortlich darum kümmern, unser Handeln in der Praxis umzusetzen:
- Befindlichkeiten: Wir wollen wir mit unserem Ärger umgehen?
- Unfähigkeiten: Was können wir tun, um unsere Kompetenzen so weiter zu entwickeln, um (auch) in Zukunft gerecht miteinander umzugehen?
- Interessenkonflikte: Wie wollen wir mit (inneren) Interessenkonflikten umgehen?
Es reicht eben nicht aus, sich als Organisation hochtrabende Werte wie Innovativität, Gemeinschaft, etc. zu geben und am Ende sich das Label „New Work“ zu verpassen. Es braucht auch die Kompetenz, meintwegen auch die inner Haltung, die Werte im Alltag zu verankern und umzusetzen.
 Michael Hübler
Michael Hübler