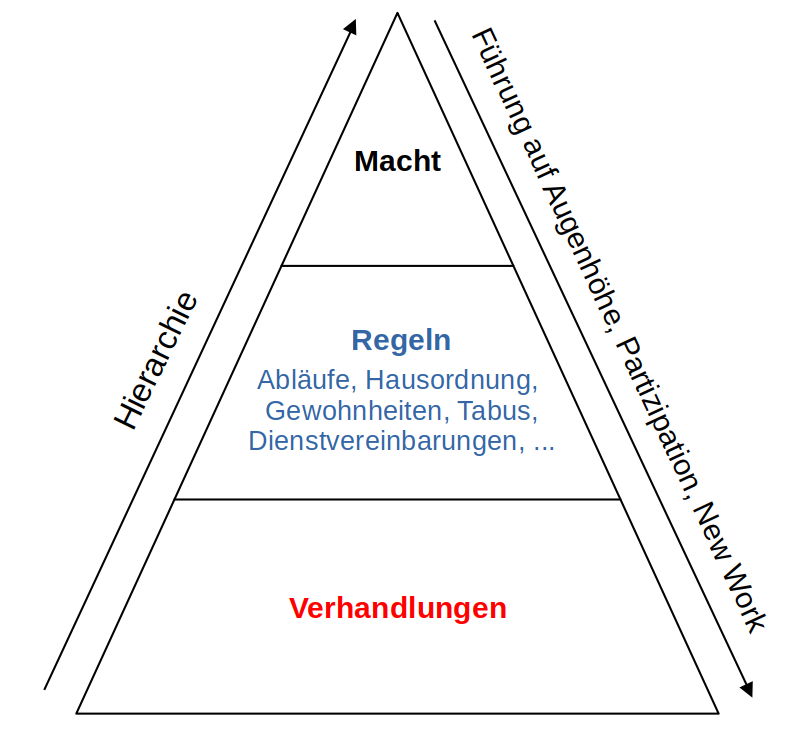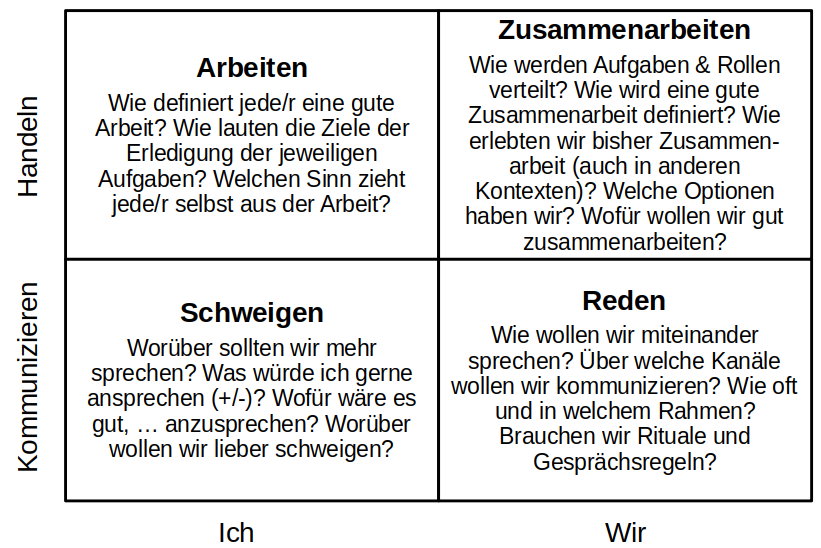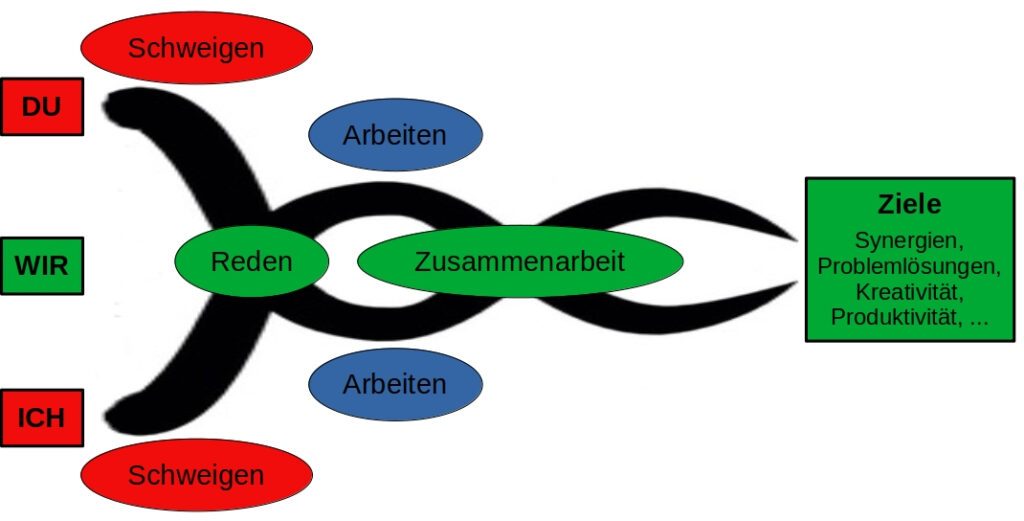In den letzten zwei Wochen waren meine Frau und ich in Bosnien-Herzegowina. Das stand schon lange auf unser Reiseliste. Aber mit Kindern und ohne Meer … Nun reisen die Kinder selbst in ferne Länder und wir sind frei, Urlaub sowohl jahreszeitlich als auch örtlich abseits des Mainstream zu machen. Also rein mit dem Reisebericht von Juli Zeh (Stille ist ein Geräusch) ins Gepäck und ab nach Banja Luka, Sarajewo und Mostar.
Eindruck 1: Bosnien gibt es gar nicht, weil keine Straßenschilder in Kroatien auf ein Land jenseits der Grenze hinweisen.
Eindruck 2: Da wir unsere erste Airbnb-Herberge in Banja Luka mitten in der Nacht nicht gleich finden, fragen wir einen jungen Mann auf der Straße nach dem Weg, der uns kurzerhand anbietet, ins Auto zu springen und mit zu fahren, weil das ohnehin auf seinem Weg liegt. Sehr sympathisch. Vor der Tür angekommen, kommen zufälligerweise unsere Gastgeber ebenfalls nach Hause und laden uns kurzerhand auf Bier und Raki ein. Sie spricht perfektes Englisch. Er schenkt nach.
Eindruck 3: In Banja Luka gibt es kein Meer, aber dafür heiße Quellen am Rand des Flusses, in denen alt und jung in Basins kostenfrei thermieren. Ungewohnt und kommunikativ. An den Quellen steht der Satz, dass die Natur für alle da sein sollte.
Die Erkenntnis: Das Land, das es über 30 Jahre nach dem Krieg von außen betrachtet immer noch nicht wirklich gibt (es gibt nur einen Reise- und einen Wanderführer, der immer noch darauf hinweist, die Wege wegen Tretminen nicht zu verlassen), scheint im Inneren recht gut zu leben. Diese Erkenntnis wird sich später fortsetzen. Wer kein Meer hat, badet eben in Flüssen unter Wasserfällen, selbst wenn die Neretva in Mostar als kältester Fluss gerade mal 12 Grad hat.

Das Meer jedenfalls scheint hier niemand außer den zu Tourist*innen zu vermissen.
Amüsante Randnotiz: Wer die DM zurückhaben will, sollte nach Bosnien-Herzegowina reisen. Dort gilt die Konvertible Mark, die damals als Äquivalent zur Deutschen Mark eingeführt wurde und immer noch etwa 1 zu 2 zum € getauscht wird.
Da das hier jedoch kein kompletter Reisebericht werden soll, geht es schnell weiter zu einem Vergleich zwischen Sarajevo und Mostar. Sarajevo wurde 4 Jahre lang belagert und zerschossen. Der Tod ist hier allgegenwärtig, da ehemals öffentliche Parks zu Friedhöfen und Parkbänke zu Brennholz verarbeitet und seitdem nicht mehr aufgestellt wurden. Sarajevo ist rastlos, laut, staubig, stickig und eng. Eine faszinierende Stadt, aber auch eine Stadt, die in mir innere Fluchtimpulse auslöste. In Mostar herrschte ebenfalls ein erbitterter, komplizierter und langwieriger Krieg. Im Vergleich zu Sarajevo ging Mostar jedoch einen anderen Weg. Freilich hat es Mostar leichter: Weniger räumliche Enge, mehr Geld durch Tourismus und einen Fluss, der an Schönheit seines Gleichen sucht sind eine Menge Holz. Doch zumindest eine Idee könnte sich Sarajevo abschauen: In Mostar kümmert sich ein Verein darum, u.a. im Rahmen von Festivals Gebäude mittels Graffiti zu verschönern. Auch in Mostar gibt es Gebäude, die man im Grunde abreißen müsste, wenn genügend Geld da wäre. Beispielsweise den Sniper-Turm, von dem aus die Scharfschützen von der kroatischen auf die bosniakische Seite schossen. Doch wenn sowohl ein Abriss als auch eine Renovierung zum Mahnmal zu teuer sind, bleibt immer noch ein Aufhübschen mit Graffiti.



Und auch der Humor darf nicht fehlen, was die reichhaltige Graffiti vor einer Justizanstalt belegt:


Was sich daraus lernen lässt: Wenn es keine perfekten Lösungen gibt, besteht immer noch die Möglichkeit, eine Situation zu verbessern und vielleicht sogar Jahrzehnte mit dieser unfertigen Situation zu leben. Was also lässt sich tun, um eine aktuell unveränderbare Situation, bspw. eine dauerhafte Unterbesetzung im Team, zumindest ein wenig erträglicher zu machen?
 Michael Hübler
Michael Hübler