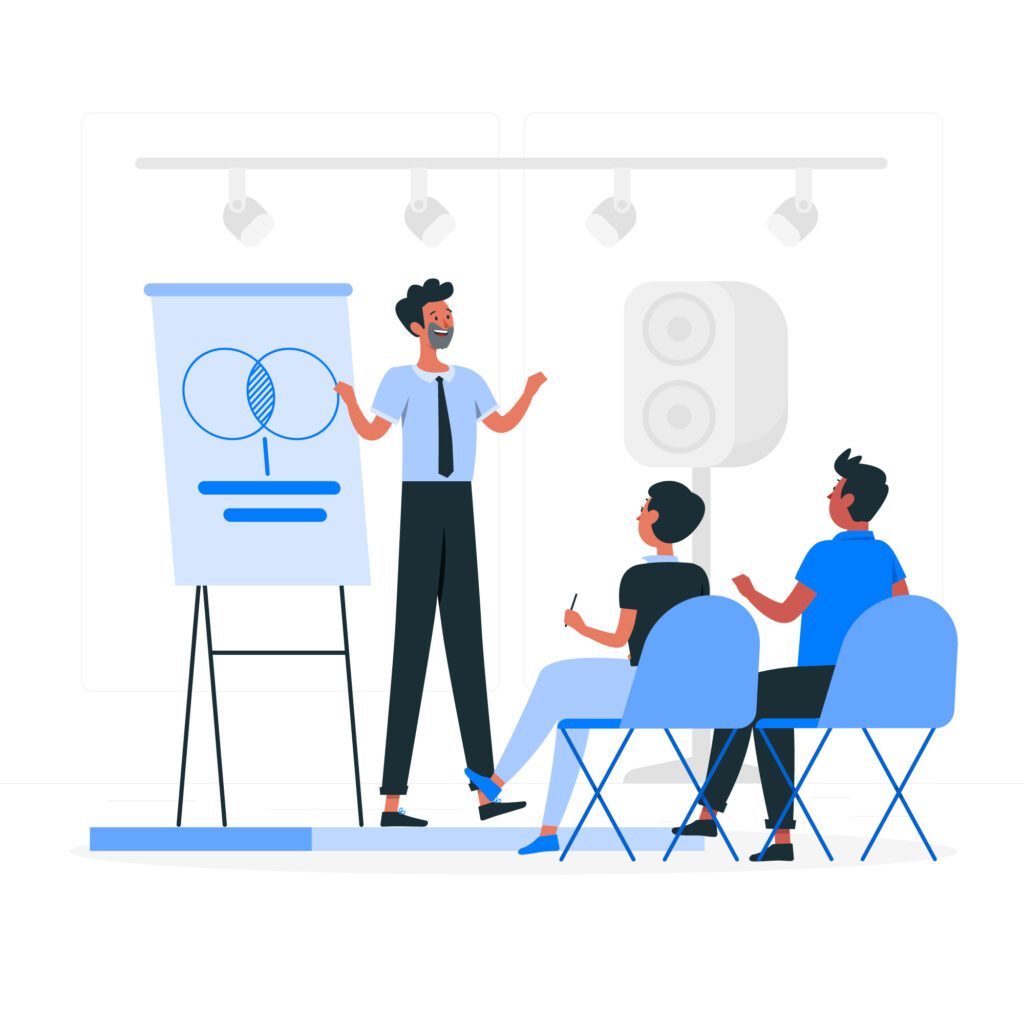
Aus meiner Sicht sind es drei Aspekte:
- Praxisbezug
- Spaß
- Bindung
1. Praxisbezug
Seminare sind keine pure Wissensvermittlung. Die Zeiten, in denen Organisationen noch Geld genug und v.a. die Zeit hatten, ihre Führungskräfte wochenlang auf Seminare zu schicken sind lange vorbei. Stattdessen habe ich immer mehr Auftraggeber, die ihren Mitarbeiter*innen nur noch einen Tag im Jahr spendieren, oft in den eigenen Räumen, manchmal auch zweimal im Jahr. Die zeitliche Überbelastung der Führungskräfte lässt häufig nicht mehr zu. Bei einem Tag bleibt jedoch wenig Spielraum für eine tiefere Beschäftigung mit einem Thema. Stattdessen braucht es schnelle Erkenntnisse und Übungen, die eine sofortige Umsetzung in die Praxis garantieren. Das wiederum erfordert einen praxisorientierten Methodenkoffer aus kurzen Rollenspielen (ohne Video-Analyse-Tamtam), Impact-Techniken oder mentalen Übungen. Kurzum: Alles, was wenig theoretisch ist, sondern stattdessen sofort spürbar macht, ob eine Vorgehensweise (Ansagen, Fragetechniken, Körpersprache) funktioniert oder nicht.
Dabei spielt der Faktor Geld aus meiner Erfahrung eine geringere Rolle als die Zeit. Wenn Organisationen schon die Dauer eines Seminars verkürzen, sind sie durchaus bereit, für einen solchen Power-Tag mehr zu bezahlen als bislang. Immerhin sparen sie sich den zweiten Tag.
2. Spaß
Wenn Seminarteilnehmer*innen mehr oder weniger gezwungen werden, an einem Training teilzunehmen, sollte es nicht nur einen inhaltlichen Mehrwert bieten, sondern auch Spaß machen. In meinen Seminaren heisst es am Ende häufig: „Der Tag ging schneller vorbei als gedacht. Hat Spaß gemacht.“ … wenn auch nicht unbedingt in dieser Reimform. Anscheinend gibt es da draußen eine Menge Trainer*innen, die glauben, Erkenntnisse müssen mit Leiden zusammen hängen. Ähnlich wie Arbeit in den Augen einiger Menschen nicht leicht sein darf, um ernsthaft Arbeit genannt zu werden, müssen auch Trainings eine gewisse seriöse Ernsthaftigkeit mitbringen.
Dieser Gedanke lässt sich auf das idealistische Denken von Hegel beziehen: Das Sein ist schwierig, aber wir können es durch unser Bewusstsein verändern. Anders formuliert: Lasst uns darüber nachdenken, wie eine gute Führung aussieht und wie wir damit unser Umfeld verändern könn(t)en.
Am Ende eines sehr idealistischen Seminars sind dann bestenfalls alle begeistert. Schließlich steht man auf der guten Seite und will wirklich etwas zum Besseren verändern. Die Atmosphäre wird geprägt von einer beinahe feierlichen Aufbruchsstimmung.
Das Problem dabei: Idealistische Denkweisen wirken schnell frustrierend, da sich Systeme nun einmal schwer und wenn, dann nur langsam verändern lassen. Zudem mangelt es idealistischen Sichtweisen oftmals an Realitätsnähe. Kein Wunder, dass dagegen manche Teilnehmer*innen rebellieren.
Externe Seminare halten es in der Regel aus, idealistisch zu sein. Hierzu melden sich schließlich hoch motivierte Menschen an. Inhouse-Seminare sollten sich mehr an dem orientieren, was in der gemeinsamen Realität vorhanden ist. Zudem drehen sich Inhouse-Seminare um ein einziges System, das ansich schon verbindend wirkt. Da es dieses eine System in offenen Seminaren nicht gibt, braucht es andere Bindungsmöglichkeiten der Teilnehmer*innen untereinander. Hierzu drängen sich Ideale geradezu auf.
Der Spaß in einem Seminar folgt einer Komödienlogik und arbeitet mit dem was da ist. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein erfolgreicher Manager wie in dem Film „Die Glücksritter“ von Eddie Murphy und müssten mit einem Bettler aufgrund von Umständen, die sich bei Interesse bei Wikipedia nachlesen lassen, die Rollen tauschen. Plötzlich bestimmt nicht mehr Ihr Bewusstsein Ihr Sein – wie bei Hegel – sondern die materiellen Umstände Ihr Bewusstsein – wie bei Marx. Sie müssen sich daher mit dem arrangieren, was materiell vorhanden ist. Und damit meine ich nicht nur die Finanzen, sondern das gesamte Umfeld. Sie müssen lernen zu improvisieren, was – wenn man es nicht zu ernst nimmt – ein erhebliches humoristisches Potential in sich birgt.
Wenn uns das nicht an Situationen erinnert, in die Führungskräfte geworfen werden, wenn das eigene Team wieder einmal dezimiert wird, weil ein junger Mitarbeiter sich unerwartet weg bewirbt und/oder jemand schwanger ist. Im Nu müssen die ehedem großen idealistischen Ziele über Bord geworfen und auf Improvisation umgeschaltet werden.
Tragisch wäre es, an den Zielen festzuhalten, weil damit wenigstens die reine Lehre aufrecht erhalten bleibt: „Ich könnte ja, wenn nicht …“
Komödiantisch wird es, wenn mit einem Augenzwinkern mit der „Materie“ improvisiert wird, die vorhanden ist: „Es hilft ja nichts, also …“
Das ernsthaft Tragische bleibt damit inhaltlich sauber. Das Komödiantische macht sich schmutzig.
Ein Spaßansatz (in Seminaren) nimmt daher paradoxerweise Teilnehmer*innen viel ernster, weil es mit der vorhandenen Realität der Menschen arbeitet: „Es ist wie es ist. Machen wir das Beste daraus.“ Und ganz ehrlich: Das, was in der Theorie gilt, wird sich in der Praxis ohnehin nur zum Teil umsetzen lassen.
(Für eine tiefere Betrachtung der Gegensätze “Tragischer Idealismus versus Komödiantischer Materialismus” siehe hier)
3. Bindung
Fluktuation, Homeoffice und Co. führten in den letzten Jahren dazu, dass die Bindung in Organisationen immer mehr abnimmt, mit weitreichenden negativen Konsequenzen für den Informationsaustausch, aber auch die Resilienz von Teams im Umgang mit Belastungen. Viele Führungskräfte wünschen sich daher mehr Austausch, bspw. kollegiale Beratungen oder regelmäßige Treffen untereinander. Noch so ein idealistisches Ziel, das leider nur selten umgesetzt wird. Zum einen mangelt es an der Zeit für die Umsetzung. Zum anderen braucht es eine klare Organisation.
Inhouse-Seminaren kommt daher die Funktion zu, diese Lücke zu füllen. Ein gutes Seminar fördert daher das Kennenlernen als auch den Austausch der Teilnehmer*innen untereinander. Ich kann daher nur empfehlen, Inhouse-Seminare verpflichtend zu machen, im Sinne von: Wir haben hier ein Angebot aus drei Führungsseminaren pro Jahr. Eines davon solltest du besuchen.
 Michael Hübler
Michael Hübler
