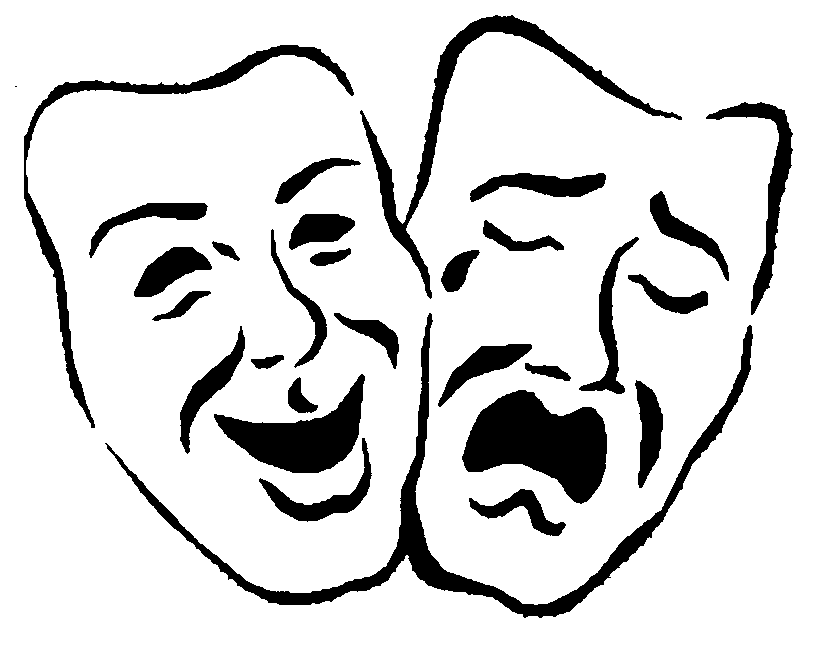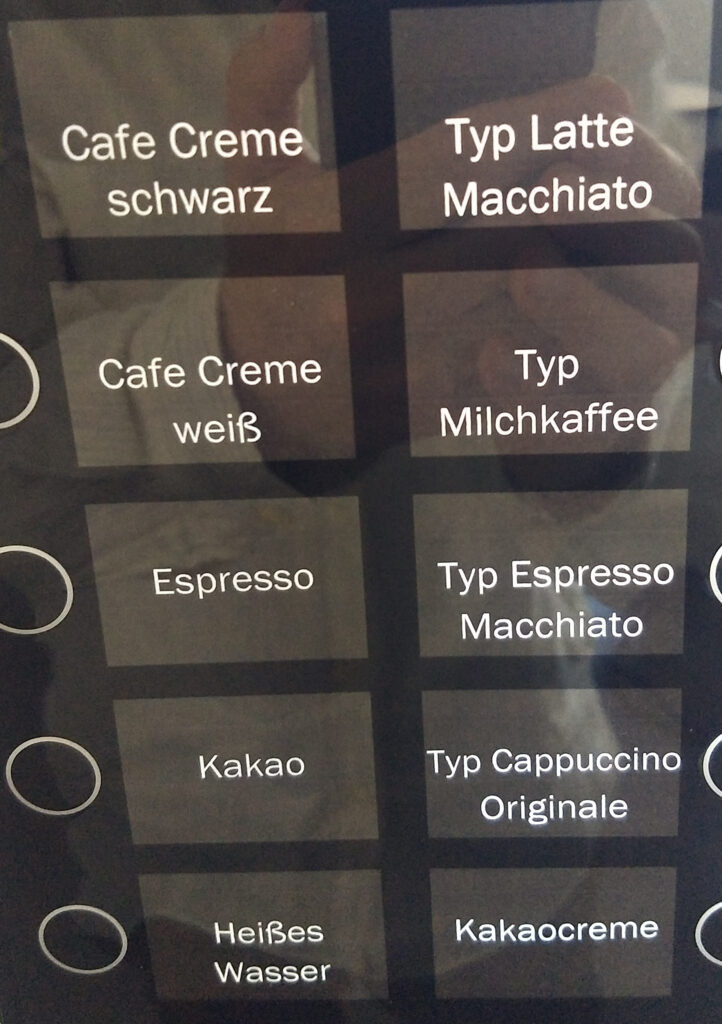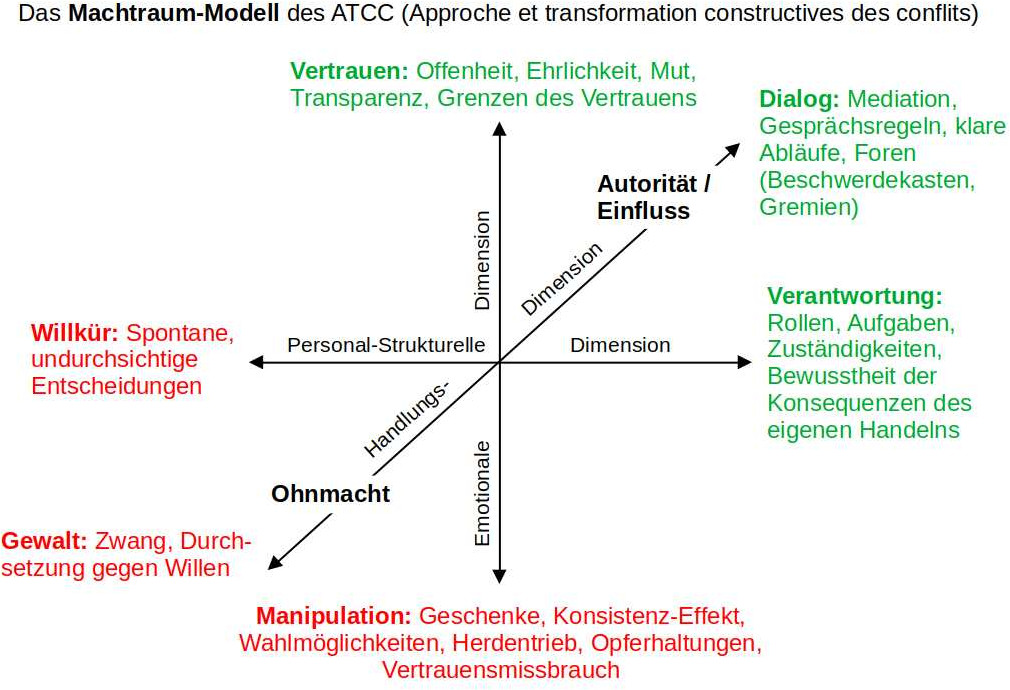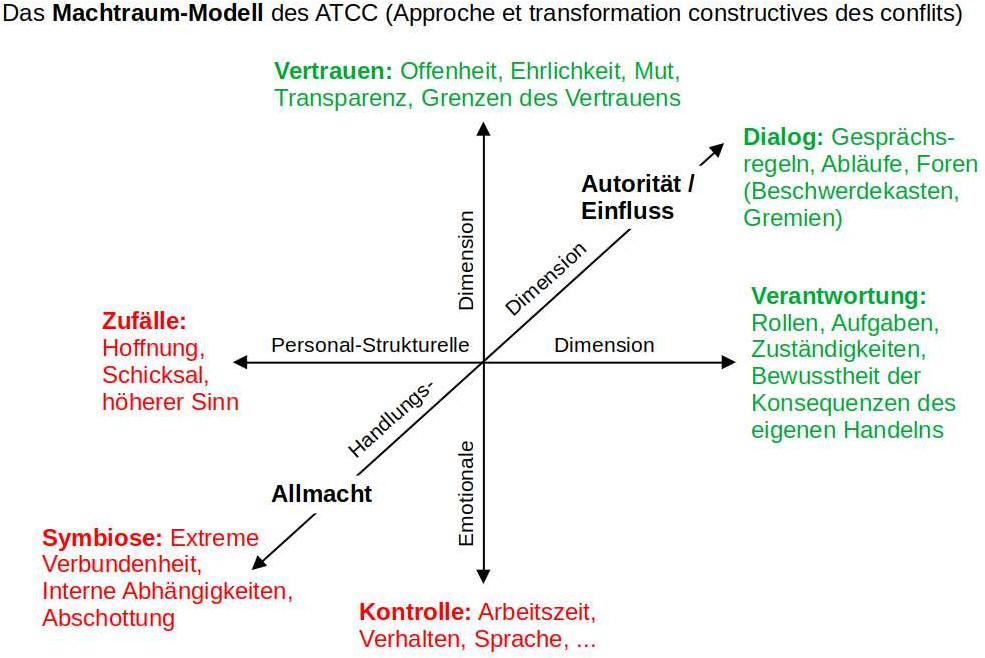Puhhh! Muss das sein? Nachdem wir jahrelang mit diesem Solo-Thema beschallt wurden. Kann es überhaupt noch jemand hören?
Die einen wollen am liebsten verdrängen, was dieses „Damals, das noch nicht so lange her ist“ passierte: Ausgangsperren, Passierscheine, Reichweitenbeschränkung, Testpflicht, Abstandspflicht, maximal Ghettofaust, 3G, 2G, Impfpflicht-Diskussionen, Auftrittsverbote, Demonstrationen, Reichtagsdrama, Geschäfts- und Schulschließungen und eine ganze Menge zwischenmenschliche Verwerfungen. Augen zu und Schwamm drüber, auf dass so etwas nie wieder passiert.
Die andere Seite bringt ein Buch nach dem anderen auf den Markt, in der Hoffnung, dass die erfahrenen Kränkungen endlich jemand wahrnimmt. Und ein Buch nach dem anderen landet tatsächlich auf den Spiegelbestsellerlisten. Dennoch ist das Thema immer noch ein Tabu. In unserer Gesellschaft ebenso wie am Arbeitsplatz.
Neulich in einem Führungsseminar, eine Stunde vor Seminarende, platzt es aus einer Führungskraft heraus. Es ging um das Thema Bindung von Mitarbeiter*innen: „Was da passierte, war Wahnsinn. In meiner Abteilung gab es eine ungeimpfte Person, die von allen anderen gemobbt wurde. Ich stellte mich damals vor diese Person und sie ist mir heute noch dankbar. Egal welchen Auftrag ich ihr gebe, und sei er auch noch so schwierig, kein Gemecker, nichts, nur Loyalität.“
Daraufhin diskutierten wir eine ¾-Stunde, was damals passierte. Es gab, wie damals auch, die üblichen verschiedenen Meinungen, die ich an dieser Stelle nur anreißen will, weil wir die Diskussionen zu Genüge kennen: Impfen als Schutz und Solidaritätsleistung, Verschwörungstheorien bis zum Verfolgungswahn, die Angst vor einem übergriffigen Staat, der Paternalismus bei Testungen erwachsener Menschen, usw.
Tatsächlich sind wir auch nicht mehr in der Not, über den Sinn und Unsinn von Maßnahmen oder die Notwendigkeit einer Impfung zu diskutieren. Der Druck ist aus dem Kessel. Doch der Deckel ist immer noch auf dem Topf. Das Wasser im Kessel kocht nicht mehr. Aber es ist immer noch heiß. Und sobald ein neues, heikles Thema aufkommt, ist das Pfeifen wieder zu hören: der Russlandfeldzug, das Drama zwischen Israel und Palästina, der Klimawandel, usw. Und mitten drin der Rechtsruck. Corona ist nicht vorbei. Es bekam nur neue Namen. Und solange dieser Elefant im Raum nicht aufgearbeitet wird, bleibt der Spalt in unserer Gesellschaft bestehen.
Dass nun Planungen im Raum stehen, das Thema politisch aufzuarbeiten, ist die eine Seite. Doch was passiert in unserer Zivilgesellschaft, in Unternehmen, Organisationen, dem öffentlichen Dienst oder Ehrenämtern?
Wir diskutierten also eine ¾-Stunde lang darüber, ob und wie das Thema auch am Arbeitsplatz noch einmal angesprochen werden sollte. Zugegeben: Keine leichte Aufgabe für Führungskräfte. Nochmal ein großes Fass aufmachen will niemand. Und was passiert, wenn die Diskussionen entgleiten? Führungskräfte sind schließlich keine Mediator*innen. Und vielleicht wollen auch die Ungeimpften das Thema nicht mehr groß ansprechen. Einzelgespräche gehen jedoch immer: „Wie ging es dir damals? Und wie geht es dir heute im Team?“
Von Sigmund Freud kennen wir das Phänomen der Aggressionsverschiebung: Wenn ich meinen Ärger dort, wo er eigentlich hin gehört, nicht anbringen kann, lebe ich ihn an einem anderen Ort aus. Wer sich folglich in der Arbeit mit niemandem austauschen konnte und das auch heute noch nicht kann, sucht sich andere reale oder virtuelle Gruppen. Langfristig gesund für unsere Gesellschaft ist das nicht.
Daher mein Appell an Führungskräfte: Haben Sie den Mut, dieses Thema noch einmal anzugehen. Die besagten Mitarbeiter*innen – sofern sie überhaupt noch da sind – werden es ihnen mit Sicherheit danken, selbst wenn es „nur“ ein Gesprächsangebot ist.
 Michael Hübler
Michael Hübler