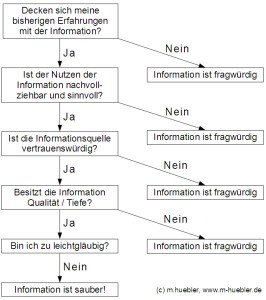In der Prioritätensetzung heißt es oft: Mach, was wichtig ist und nicht nur, was dringend erscheint. Lass dir nicht alles von außen diktieren, vor allem nicht die Dringlichkeit einer hektischen Welt und eines hektischen Chefs, wo wir doch insgeheim wissen, dass sich manche Aufgabe auf den zweiten Blick leichter lösen ließe, als mit heißen Nadeln zu stricken. Sie kennen ja die Unterscheidung zwischen dem frühen Vogel und der zweiten Maus, die den Speck kriegt.
Also wichtig statt dringend! Doch was genau ist wichtig?
Sehen wir uns die Kategorie wichtig genauer an, wird deutlich, dass alles Wichtige früher oder später Konsequenzen nach sich zieht. Unterteilen wir den Begriff der Konsequenzen, kommen wir auf drei wesentliche Unterscheidungen:
-
Konsequenzen für eine Vielzahl von Beteiligten, die dazu noch
-
langfristig wirken, sind
-
meist gravierend und schwer aushaltbar.
Damit unterteilen wir Konsequenzen in eine quantitative, zeitliche und qualitative Dimension.
Würstchen- oder Wetterfrage?
Warum diese Unterscheidung so wichtig ist, zeigt sich spätestens bei Menschen mit Entscheidungsschwäche. Zur Verdeutlichung stelle ich das Würstchen- dem Wetterparadigma gegenüber: Stellen Sie sich vor, Sie müssen bei einem Tag der offenen Tür entscheiden, was es zu Essen gibt. Konkret haben Sie die Auswahl zwischen groben und feinen Bratwürsten. Klingt banal. Manche von uns machen sich darüber allerdings umfangreiche Gedanken. Lassen Sie uns die Konsequenzen durchgehen:
-
Wird es viele Personen betreffen? Ein paar sicherlich. Die meisten werden jedoch so oder so zufrieden sein. Der Erfolg der Veranstaltung hängt jedoch sicherlich von anderen Faktoren ab.
-
Wird es langfristige Konsequenzen haben? Nicht wirklich. Ich würde sagen: Bis zum nächsten Stuhlgang. Die Wahrscheinlichkeit, dass noch Jahre später vom Frevel des falschen Würstchens gesprochen wird, hält sich in Grenzen.
-
Manche Gäste werden meckern. Die tun das immer. Wir tun ihnen sogar einen Gefallen, wenn nicht alles perfekt ist. Ist das Gemecker auszuhalten? Unbedingt!
Schauen wir uns stattdessen die Entscheidung an, bei einer Regenwahrscheinlichkeit im schönen Sommermonat Juni von 30% draußen zu feiern:
-
Es wird alle Personen betreffen! Vielleicht sogar die Technik oder das durchweichte Essen. Darauf müssen wir uns einstellen bzw. Schutzmaßnahmen überlegen.
-
Wird es langfristige Konsequenzen nach sich ziehen? Natürlich! Immerhin geht es nicht nur darum, dass Gäste eventuell früher gehen, sondern insgesamt um den Ruf der Organisation.
-
Wenn es regnet, gehen die Gäste früher. Scheint die Sonne, schwitzen sie in den Innenräumen und gehen ebenso früher. Die Unlösbarkeit dieses inneren Dilemmas lässt sich nur auf einer anderen Ebene lösen: Welches Bild wollen Sie vermitteln? Welche Werte wollen Sie transportieren? Wollen Sie mutig sein, und dem Regen trotzen? Oder gehen Sie auf Nummer Sicher? Was ist leichter auszuhalten? Der Spruch: Ihr Luschen! Beim kleinsten Tropfen geht ihr nach drinnen! Oder: Ihr seid ganz schön wagemutig, vielleicht sogar verrückt!
Was lernen wir aus all dem?
-
Vertauschen wir die Würstchen mit Beamer oder Digitalkamera, stoßen wir auf eine Menge alltäglicher Entscheidungen, deren Konsequenzen wir maßlos überschätzen. Nach spätestens drei Monaten kommt wieder ein neues Gerät auf den Markt und wir können mit unserer Recherche von neuem beginnen. Letztlich kommt es nicht darauf an, das perfekte Gerät zu kaufen, sondern aus dem was wir haben, das beste zu machen. Nach einem halben Jahr haben wir uns schließlich so an das ehemals Neue gewöhnt, dass wir ganr nicht mehr verstehen können, warum wir uns zuvor nicht entscheiden konnten.
-
Vertauschen wir Wetter mit Urlaub, Mitarbeitergespräch oder Seminar ergibt sich eine Vielzahl an Situationen, die wir niemals vollständig vorausdenken können. Planung erscheint wichtig, wird aber immer nur einen Teil des Erfolgs eines Gesprächs oder einer Veranstaltung ausmachen. Was also ist das Wesentliche, das wir vermitteln oder erreichen wollen?
 Michael Hübler
Michael Hübler