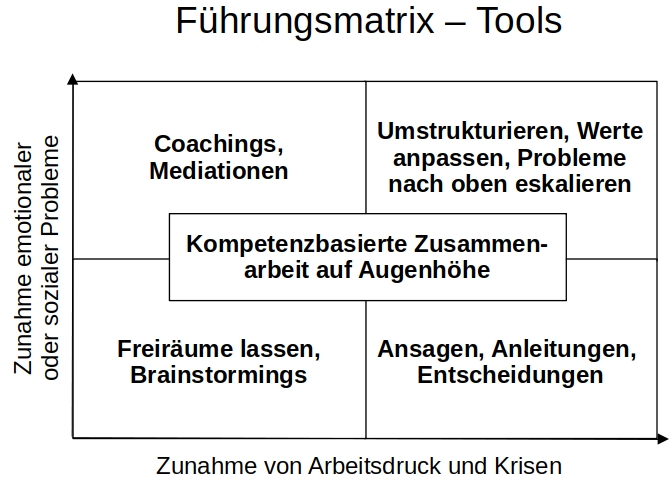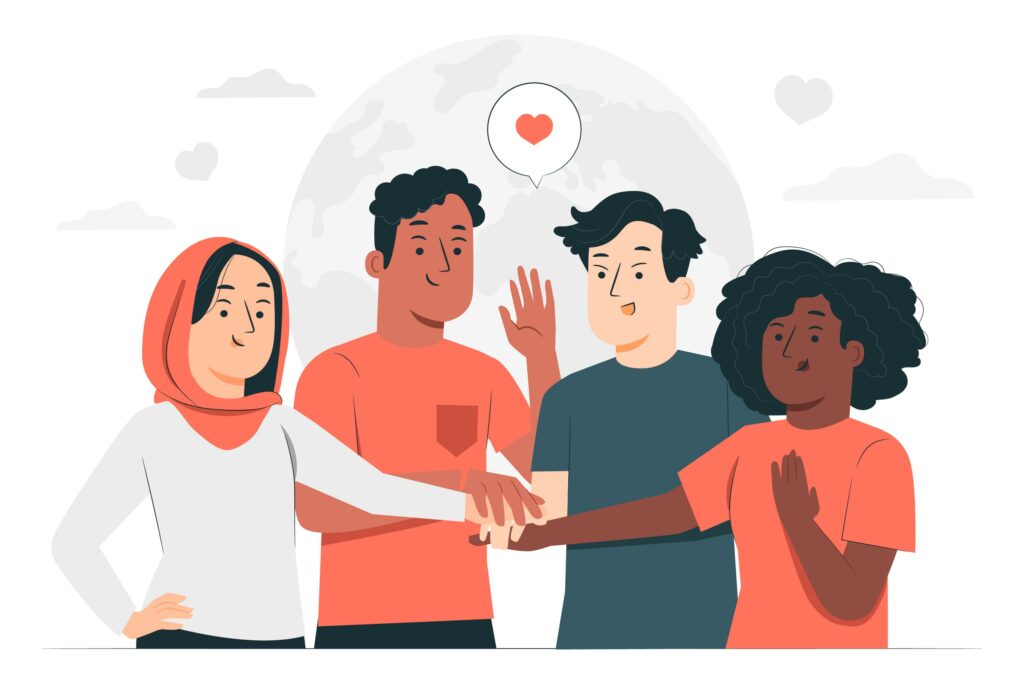Bild von storyset auf Freepik
Seitdem ich das Prinzip der Radikalen Akzeptanz in meine Seminare einbaue, gibt es jedes mal 2-3 Teilnehmer*innen, für die genau das das Highlight des Trainings ist. Schon allein der Begriff ist ein Hinhorcher.
Für welche Situationen eine Radikale Akzeptanz sinnvoll ist und wie ein grundsätzlicher Zugang zur Radikalen Akzeptanz aussieht, habe ich hier beschrieben.
Doch wie genau funktioniert es, Situationen, die ich nicht ändern kann radikal anzunehmen? Dazu gibt es einige Techniken:
Realitäts-Check
Kern der Radikalen Akzeptanz ist die Vergegenwärtigung, dass unsere Gedanken sich von der Realität unterscheiden. Diese banale Tatsache ist bisweilen ein unerheblicher Teil unseres Alltags, erweist sich jedoch – insbesondere bei negativen Affirmationen – als besonders wichtig.
Unser aktuelles Denken weicht sehr häufig von der Realität ab. Wir haben Tagträume, denken an den kommenden Urlaub oder haben eine Idee für das anstehende Projekt. Manchmal hängen wir jedoch auch Glaubenssätzen an, die sich weder jetzt noch später mit der Realität decken werden.
Ergänzen Sie bitte den folgenden Satz: „Ein Indianer kennt keinen …“
Offensichtlich ist es unmöglich, das fehlende Wort nicht zu denken. Dabei wissen wir genau, dass der Satz Blödsinn ist. Und wenn nicht: Was wäre, wenn Sie auf der Straße einen Indianer träfen, der Sie nach einer Schmerztablette fragt? Geben Sie ihm dann eine Tablette und denken gleichzeitig an diesen Satz? Oder sagen Sie ihm: „Ne, ne, ne. Weißte ja selber, dass das nicht stimmen kann.“
Wir Menschen sind schon was Besonderes. Wir sind wohl die einzige Spezies, die gleichzeitig etwas tun und etwas Gegenteiliges denken kann. Oder wir sind uns bewusst, dass das, was wir denken unsinnig ist und denken es trotzdem.
Die Indianer-Szene erscheint uns nicht nur amüsant. Deren Wahrheitsgehalt ließe sich auch mehr oder weniger einfach überprüfen.
Weniger amüsant wird es bei verbaler Selbstgeißelung, wenn wir bspw. nach einer Kündigung zu uns sagen: „Das war ja von Anfang an klar“ oder „Du hättest dich mehr reinknien sollen“. Umso wichtiger ist hier ein genauer Realitäts-Check:
- Was genau war von Anfang an klar?
- In welchen Momenten hätte ich mich mehr anstrengen sollen?
- Was hätte das konkret verändert?
Hätte ich tatsächlich etwas verändern können, gilt es, eine Lehre aus der Situation zu ziehen. Wenn nicht, kann ich die Situation nur radikal akzeptieren.
Typische Muster erkennen
Um nicht wieder in seine üblichen Reiz-Reaktionsmuster zu verfallen, ist es hilfreich, sich selbst gut zu beobachten und seine üblichen Muster zu erkennen. Das bereits erwähnte Beispiel der Kündigung könnte als typisches persönliches Muster bei manchen Menschen die Selbstgeißelung nach sich ziehen. Andere werden in einem solchen Fall wütend und anklagend: „Das ist mal wieder typisch für die da oben. Denen ist doch egal, was aus einem einfachen Angestellten wird.“
Solche internen Muster binden jedoch eine Menge Energie und verhindern eine kreative Auseinandersetzung mit der Situation. Auf der Basis einer Radikalen Akzeptanz des Ist-Zustands könnte ich die Situation stattdessen abhaken und meine Energie in Bewerbungen stecken.
Gedanken erkennen und einordnen
Eine Vorstufe der Mustererkennung kann das bloße, wohlwollende Wahrnehmen der eigenen Gedanken sein: „Aha. Da kommt mal wieder dieser Ärger oder diese Selbstzerfleischung.“
Diese Gedanken können zudem kategorisiert werden:
- Ah, da ist mal wieder eine Prophezeiung.
- Ich vergleiche mich mal wieder mit meinem Bruder.
- Ich bewerte mich mal wieder.
Den Mustern einen Krankheitsnamen geben
Ebenso kann es hilfreich sein, den eigenen Mustern einen Namen zu geben, der an Krankheiten erinnert:
- Beschuldigeritis: Wenn ich den Fehler mal wieder bei allen anderen suche, nur nicht bei mir.
- Rechthaberitis: Wenn ich mal wieder unbedingt Recht haben muss, anstatt mir die Situation genauer anzusehen.
- Bewerteritis: Wenn ich mich selbst mit allem, was ich tue, negativ bewerte.
- Übertreiberitis: Wenn ich mich selbst an Maßstäben messe, denen ich niemals gerecht werden kann.
- Analyseritis: Wenn ich mich selbst analysiere und mich damit fertig mache.
- Ironisiereritis: Wenn ich die Situation ins Lächerliche ziehe, anstatt der Wahrheit ins Auge zu blicken.
- Ablenkeritis: Wenn ich mich anstatt der Situation zu stellen, mit ganz anderen Dingen beschäftige.
- Fluchteritis: Wenn es das alles nicht wahrhaben will.
Externalisieren
Externalisieren schließlich ist eine oft genutzte therapeutische Methode zum Umgang mit schwierigen Situationen. Sobald Probleme schreibend oder zeichnend auf Papier gebracht werden, verlieren sie häufig ihre Dramatik. Kein Wunder, dass so viele Menschen immer noch Tagebuch schreiben.
Matthias Wengenroth: Das Leben annehmen. Huber
 Michael Hübler
Michael Hübler