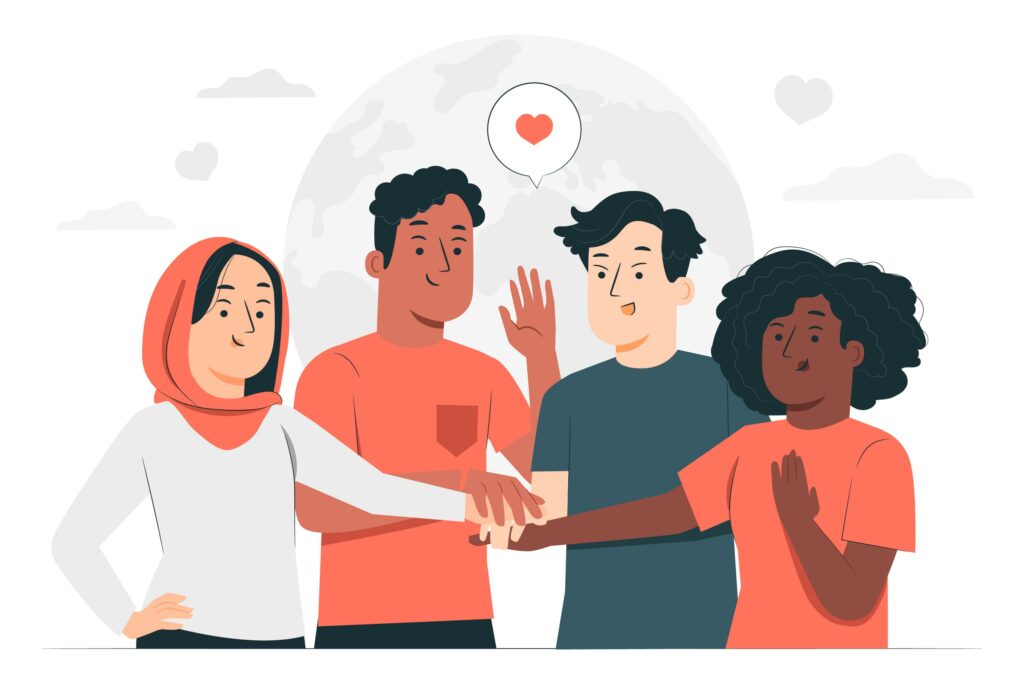
Bild von storyset auf Freepik
Wie der Biologe Frans de Waal in seinem Buch „Der Mensch, der Bonobo und die 10 Gebote“ darstellt, gibt es zwei widerstreitende Maximen zum Thema Helfen: Die „Altruismus-muss-weh-tun“- und die „Altruismus-fühlt-sich-gut-an“-Hypothese.
Kostet anderen zu helfen einen Preis?
Dass anderen zu helfen mit Schmerzen verbunden sein muss, war lange Zeit die Haupterklärung für Altruismus. Wer anderen hilft, ist naiv. Und wenn schon geholfen wird, ist das zumindest erklärungsbedürftig. Die Grundannahme dahinter lautet: Wir leiden jetzt, indem wir uns für andere aufopfern, um später einen Vorteil daraus zu ziehen. Wir ziehen unsere Kinder auf, damit wir im Alter nicht alleine sind. Wir helfen Freunden beim Umzug, damit wir bei Bedarf ebenso Hilfe bekommen. Oder wir unterstützen Kolleg*innen, damit wir uns, wenn wir einmal ganz oben in der beruflichen Nahrungskette stehen, auf eine breite Unterstützungsbasis verlassen können.
Diese Denkweise hat auch heute noch in vielen Bereichen Gültigkeit, wenn es heißt, man solle sich nicht über den Tisch ziehen lassen und jede*r soll sich in unserer neoliberalen Welt am besten um sich selbst kümmert, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Und ganz falsch ist das nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass wir uns durch ein altruistisches Verhalten Freunde machen, die uns bei Bedarf später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit unterstützen werden.
Gleichzeitig klingt dieser Ansatz doch sehr strategisch, als würden wir genau deshalb helfen, um später Hilfe zu bekommen. Dass diese Herangehensweise nicht funktioniert, zeigt Adam Grant in seinem Buch „Geben und Nehmen“. Grant stellt dar, dass wir am meisten Hilfe zurückbekommen, wenn wir selbst keine Hintergedanken haben. Die strategische Version ist zu manipulativ.
Was wir alles denken, um anderen nicht helfen zu müssen
Die Altruismus-mit-Schmerzen-Hypothese kam jedoch in den letzten Jahren v.a. durch bildgebende Verfahren unter Druck. U.a. wurde von einem Team um James Rilling von der Emory University festgestellt, dass wir in sozialen Situationen zuerst den Impuls haben, anderen zu helfen und dann erst darüber nachdenken, ob diese Hilfe gut oder schlecht ist (de Waal, 2015, S. 72).
Kognitive Begründungen für eine Nichthilfe können entsprechend der „Altruismus-tut-weh“-Hypothese vielfältig sein:
- Du machst dich hier zum Affen.
- Ist das nicht übergriffig?
- Bloß nicht einmischen.
- Am Ende fühlt sie sich von dir angemacht.
- Wer zu viel hilft, macht andere abhängig.
- Und bei gehandicapten Menschen: Wie helfe ich hier am besten? Vielleicht will der das gar nicht.
Kurzum: Als erstes taucht der Impuls zu helfen auf. Dann jedoch finden wir eine Menge Gründe, warum es unpassend ist.
Öfter mal zum Affen machen
Wie de Waal zeigt, ist dieser Impuls ein Erbe unserer tierischen Vorfahren. Sowohl Schimpansen als auch Bonobos lösen eine Menge Konflikte, indem sie beispielsweise Kontrahenten nach einem Streit zur Versöhnung sanft aufeinander zu schieben oder anderen die Tür zu einem Futterraum öffnen, obwohl sie selbst dadurch weniger Futter bekommen.
Aber gehen insbesondere Schimpansen nicht oftmals aggressiv miteinander um? Dies liegt meist an der Enge und fehlenden Fluchtmöglichkeiten in einer unnatürlichen Umgebung. Zum Vergleich: In einen einstöckigen Nahverkehrs-Reisezugwagen passen inklusive stehenden Personen etwa 150 Menschen. Stellen wir uns vor, der Zug strandet bei Vollbesetzung zwischen zwei Haltestellen im Nirgendwo. Bei einer sommerlichen Hitze von 30 Grad. Die Klimaanlage fällt aus. Zudem ist unklar, wie lange der Aufenthalt dauert. Wie lange dauert es wohl, bis die ersten Menschen darin ungehalten reagieren? Nebenbei: Gibt es schon eine Serie über Geschichten, die Menschen erleben, wenn die Bahn Verspätung hat? Wenn nein, warum nicht? Netflix, Amazon oder Disney, wie wär’s?
Unsere weniger sozialisierten Vorfahren denken vermutlich weniger als wir über Gründe nach, warum sich gegenseitig zu helfen falsch ist. Vielleicht sollten wir uns viel öfter „zum Affen machen“. Aber vielleicht steckt dahinter auch eine große Kränkung. Wie Sigmund Freud bereits anmerkte: Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Und Frau wohl auch nicht. Freud meinte damit, dass unser Es, d.h. unsere unbewussten Impulse, uns oftmals mehr leiten, als uns lieb ist.
Wobei der Geschlechterunterschied, wenn wir schon dabei sind, ein gutes Stichwort ist: Nach de Waal reagieren bereits neugeborene Mädchen stärker auf Gesichter, während das männliche Geschlecht stärker auf mechanisches Spielzeug reagiert. Später sind Mädchen prosozialer als Jungs, achten mehr auf Stimmen, können emotionale Ausdrücke besser deuten, sind empathischer und haben mehr Gewissensbisse, wenn sie andere verletzen (de Waal, S. 75).
Geht es also gar nicht darum Chef*in im eigenen Haus zu sein, sondern besser auf die eigenen inneren Impulse zu horchen, ohne sie mit logischen Argumenten beiseite zu schieben?
Helfen macht Spaß
Schauen wir uns genauer an, welche Tätigkeiten bei uns Menschen mit Lust verbunden sind, wird deutlich, dass biologisch alles, was uns im ersten Moment keinen Vorteil bringt, jedoch wichtig für unser Überleben als Mensch oder Menschheit ist, mit positiven Emotionen vernetzt ist:
- Das Stillen unseres Hungers gibt uns ein befriedigendes Gefühl. Der Geschmack von Salz, Zucker, Pfeffer, Knoblauch, usw. ist dabei auch nicht zu vernachlässigen.
- Wie Sex funktioniert brauche ich wohl nicht zu erläutern.
- Und die Königsdisziplin des Helfens – die Brutpflege – funktioniert ebenso nur durch positive Emotionen.
Einfach formuliert werden beim Helfen – und zwar nicht nur den eigenen Nachkommen, sondern auch der alten Dame am Ticketautomaten – Bindungshormone (Oxytocin) ausgeschüttet, die uns über unsere Spiegelneuronen beinahe das Gefühl geben, uns selbst zu helfen. Schaffen wir es, die unterstützte Person zu ihrem Ziel zu führen, haben wir damit auch das Gefühl, selbst ein Ziel erreicht zu haben. Dadurch werden Glücks- und Belohnungsgefühle im Nucleus accumbens ausgelöst, wodurch wir uns gemeinsam über diesen Erfolg freuen können.
Und damit sind wir bei der „Altruismus-fühlt-sich-gut-an“-Maxime angekommen. Der Grundgedanke dahinter lautet also: Wenn wir schon weniger an uns selbst denken, sollte es sich gut anfühlen, anderen zu helfen, damit wir es auch tun.
Um andere zu unterstützen brauchen wir also nicht einmal Mut, sondern lediglich das Im-Zaun-halten der inneren Stimmen, die uns suggerieren, wie naiv und unpassend es doch ist, anderen zu helfen.
 Michael Hübler
Michael Hübler