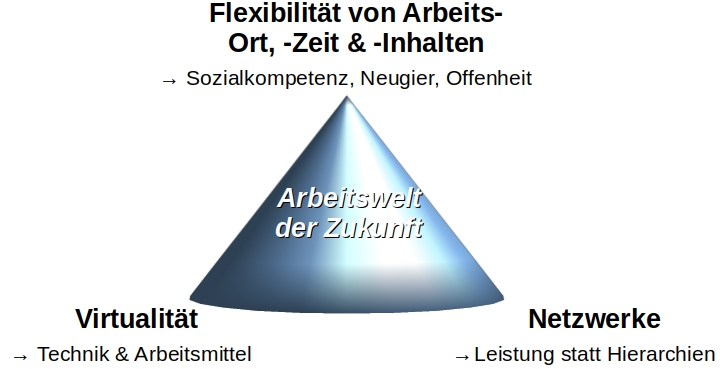… und was die Quantenphysik mit Grenzziehungen zu tun hat.

Bild von rocketpixel auf Freepik
Grenzen als Machtinstrument
Grenzen bedeuten und verdeutlichen Macht, was nirgendwo deutlicher wird als auf einer Landkarte: Landesgrenzen zeigen, wer über welchen Bereich Verwaltungs- und Regierungsmacht besitzt. Wer über Macht verfügt, kann Grenzen setzen, bspw. als Eltern bestimmen, was zuhause erlaubt ist und was nicht. In Unternehmen werden Grenzen oft durch den Zugang zu Ressourcen definiert. Werden Grenzen akzeptiert, wird auch die Macht des oder der Grenzen-Definierenden akzeptiert. Werden Grenzen abgelehnt, kommt es zu Auseinandersetzungen.
Fließende Grenzen
In der Natur gibt es auch Grenzen, insbesondere zwischen Wasser und Land. Diese Grenzen sind allerdings nicht starr, sondern fließend, was anhand von Ebbe und Flut sehr deutlich wird. Ähnliche natürliche Grenzen gibt es bei Charaktereigenschaften von Menschen. Wenn wir sagen, jemand ist unpünktlich oder unzuverlässig, klingt das, als hätten wir es hier mit klar zu beschreibenden Grenzen zu tun. Dabei definiert sich die Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit erst durch den Vergleich mit der Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit anderer. Nehmen wir jedoch die klar definierten und oftmals mit dem Lineal gezogenen Landesgrenzen auf einer Landkarte (siehe die Grenzen der US-Bundesstaaten) als Vorbild für menschliche Eigenschaften anstatt der natürlichen Grenzziehungen an einem Meeresufer, sind Konflikte vorprogrammiert, da Grenzen dann nicht mehr als fließend betrachtet werden, sondern machtvoll definiert und durchgesetzt werden wollen. Wäre es stattdessen nicht eine spannende Vorstellung, sich einen Flussverlauf oder einen Berggrad als Vorbild zu nehmen? So wie die Grenzen durch den Bayerischen Wald, die Oder, Maas, Our, den Rhein, Bodensee und die bayerisch-österreichischen Alpen Tschechien, Polen, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich, die Schweiz und Österreich unscharf von Deutschland trennen, sind auch Eigenschaften von Menschen unscharf und bieten damit eine jederzeit fließende, immer wieder neu zu definierende Diskussionsgrundlage.
Klassische Physik versus Quantenphysik
Einen großen Anteil an unserem Verständnis von Grenzen hat die klassische Physik:
- Ein Schalter ist an oder aus.
- Ein Objekt wird magnetisch angezogen oder nicht.
- Ein Objekt schwimmt oder geht unter.
In der Quantenphysik werden diese strikten Grenzen aufgehoben (siehe für eine kurze und einfache Einführung hier (externer Link): https://www.youtube.com/watch?v=tt0uynvzBUQ). Von weitem scheinen die Grenzen unseres Körpers oder der Erde klar definiert zu sein. Je näher wir jedoch herangehen, desto unschärfer werden die Grenzen und desto unklarer wird es, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Aus der Nahsicht sind Grenzziehungen zwischen Land und Wasser nicht mehr so eindeutig wie aus der Ferne. Und in unserer Haut nisten sich Partikel ein, die nicht zu uns gehören, bspw. die Luft unter unseren Nägeln oder Mikroben auf der Haut. Betrachten wir unseren Körper noch genauer, erkennen wir, dass die Atome und Elektronen als kleinste Bausteine unseres Körpers niemals still stehen, sondern immer in Bewegung sind. Deshalb geht die Quantenphysik davon aus, dass ein Zustand wie eindeutig 0 oder eindeutig 1 nur selten vorkommt. Stattdessen befindet sich ein Objekt, bzw. dessen Atome, in der Mehrzahl der Momente in einem Zustand zwischen 0 und 1. Fällt bspw. ein Glas auf den Boden, ist es (evtl.) erst ganz am Ende eindeutig kaputt. Im Moment des Aufpralls ist es sowohl ganz als auch kaputt. Es hat sich sozusagen noch nicht entschieden, pendelt also zwischen 0 und 1.
Übertragen wir dieses Phänomen auf uns Menschen gibt es auch hier in den wenigsten Fällen Menschen, die eindeutig unzuverlässig oder unpünktlich sind. Auch hier sind die Grenzen fließend.
Grenzen fördern die eine temporäre Fokussierung
Dennoch brauchen wir Grenzen, um uns zu fokussieren. Würden wir tatsächlich annehmen, dass alles fließend ist, würde uns dies sicherlich überfordern. Als Führungskraft müssen Sie eine (künstliche) Grenze zu Themen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Motivation, Kundenfreundlichkeit, usw. definieren. Diese Grenze besteht jedoch lediglich für den aktuellen Zeitpunkt und ist als Diskussionsgrundlage beständig auf dem Prüfstand.
Damit wird deutlich, dass Grenzen nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich variabel sind. Dass sich für den Aufenthaltsort eines Elektrons lediglich eine Wahrscheinlichkeit berechnen lässt, bedeutet auch, dass das Elektron irgendwann einmal an einem x-beliebigen Ort auftauchen wird. Entsprechend sind auch die Grenzen, die wir selbst setzen variabel – oder sollten es sein. Stellen wir heute eine Regel auf, ist diese Regel von der Zeit abhängig, in der sie aufgestellt wurde und kann (oder sollte) sich entsprechend mit dem zeitlichen Kontext weiterentwickeln.
 Michael Hübler
Michael Hübler