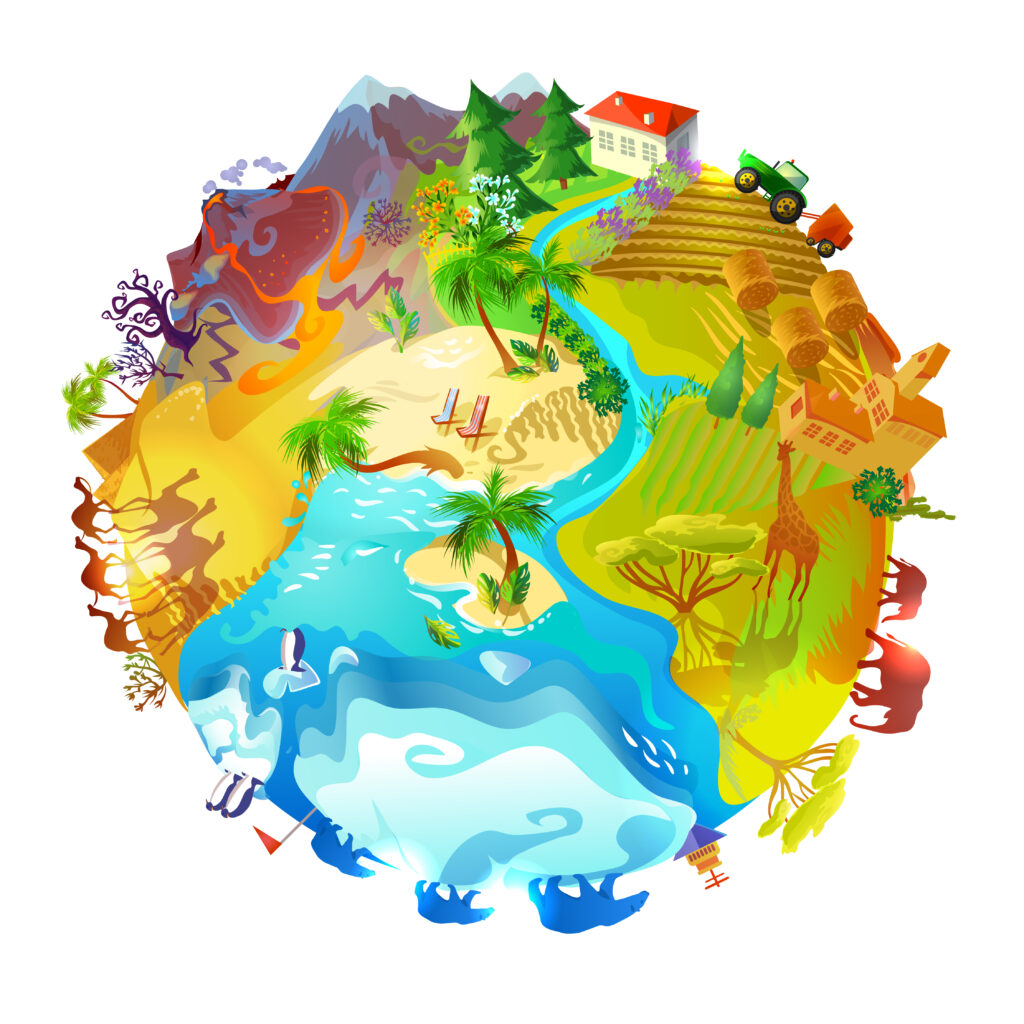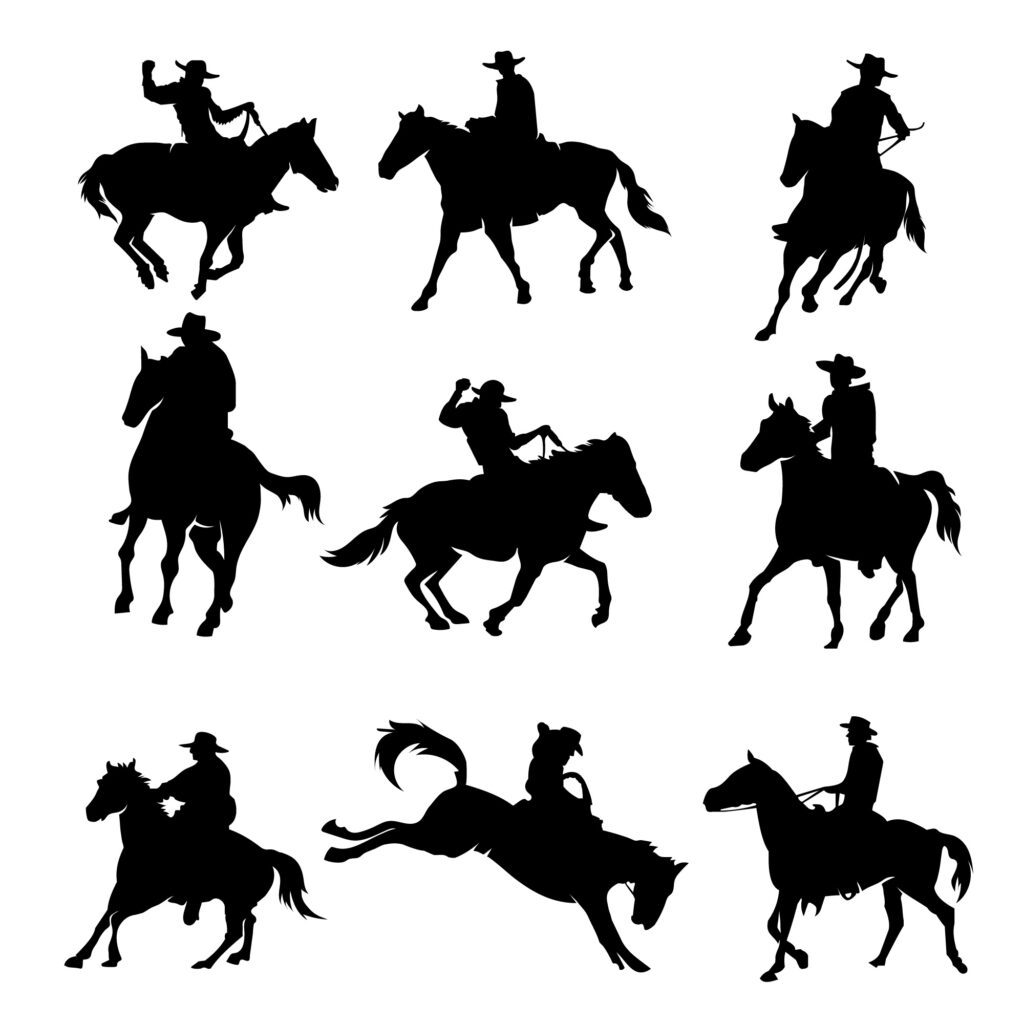
Bild von Freepik
Was erfahren wir über Persönlichkeitstests?
Psychologische Persönlichkeitstests in Unternehmen sollen ergründen, was Mitarbeiter*innen als Menschen ausmacht, was ihnen wichtig ist, was sie stresst und wie sie folglich geführt werden können, um erfolgreich(er) zusammen zu arbeiten.
Nehmen wir dazu als Beispiel das sehr häufig eingesetzte DISG-Modell:
- Ein dominanter Stil steht u.a. für Entschlossenheit, Willensstärke, Konkurrenzdenken, Ergebnisorientierung, Durchsetzungsfähigkeit, Direktheit, Mut, manchmal auch Sturheit, Aggressivität, Hartnäckigkeit und Ungeduld.
- Ein initiativer Stil deutet u.a. auf Beziehungsorientierung, Emotionalität, Gesprächigkeit, Optimismus, Spontaneität oder Geselligkeit hin.
- Ein stetiger Stil zeigt sich u.a. in Treue, Loyalität, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Unterstützung, Bescheidenheit, Geduld, Pragmatik, Zuverlässigkeit, Aufmerksamkeit, Beständigkeit und Verbindlichkeit.
- Ein gewissenhafter Stil schließlich äußert sich u.a. über hohe Maßstäbe, Detailorientierung, Disziplin, Vorsicht, umfangreiche Analysen, Logik, Genauigkeit, Gründlichkeit und Vorausplanung.
Damit wird jedoch lediglich die Oberfläche einer Person beschrieben. Als Persona wird die nach außen gezeigte Einstellung eines Menschen bezeichnet. Dieses Bild kann mit dem Ich einer Person identisch sein, muss es jedoch nicht. Es kann sich auch lediglich um eine nach außen getragene Identität handeln, um gut durchs Leben (oder die Arbeit) zu kommen.
Am Beispiel des DISG-Modells: Vielleicht wurde ein Mitarbeiter so sozialisiert, dass er glaubt, mit einem gewissenhaften Stil würde er es am weitesten in der Arbeit bringen und Karriere machen. Oder aber der dominante Stil ist nicht nur ein Stil, sondern tatsächlich ein wesentlicher Teil des Ichs dieser Person.
Mit Hilfe eines Persönlichkeitstests finden wir also heraus, wie ein Mensch in seiner Umgebung auftritt, weil er glaubt, dass er so am besten (leichtesten, erfolgreichsten, reibungsfreiesten, …) durchs Leben kommt.
Die Frage nach dem Wofür?
Das gleiche Prinzip gilt für alle mir bekannten Persönlichkeitstest, was auch logisch ist. Es handelt sich schließlich um Persönlichkeits- und keine Ich-Tests. Aber reicht das aus? Wollen, dürfen oder sollten Führungskräfte hier eine Grenzen ziehen? Schließlich ist Führung keine Psychotherapie.
Wer mehr wissen will, kann sich in ein Gebiet einarbeiten, das seine Höhepunkte der Beliebtheit in den 70er bis 90er Jahren hatte, heute jedoch kaum noch bekannt ist: Die Transpersonale Psychologie. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Richtung ist vermutlich Abraham Maslow. Die meisten werden sich an seine Bedürfnispyramide erinnern. Ganz oben in der Pyramide steht unter Selbstverwirklichung: Das eigene Potential voll ausschöpfen und damit eine Art Ich der Zukunft anzustreben.
Oder Sie stellen die Wofür-Frage. Ich beispielsweise bin ab und an dominant. Wofür?
- Weil ich ungeduldig bin und will, das etwas vorwärts geht.
- Weil ich manchmal denke, ich weiß es besser – was manchmal stimmt und manchmal nicht, vermutlich eine Trainer-Krankheit.
- Weil ich meine Freiheit liebe und gerne selbst entscheide, bevor jemand anders über mich entscheidet.
Ich kenne aber auch die anderen Stile sehr gut:
- Initiativ bin ich, weil ich weiß, dass eine gute, optimistische Zusammenarbeit mehr bringt und mehr Spaß macht, als nur alleine in meinem Kämmerchen vor mich hin zu werkeln.
- Stetig bin ich, weil mir langfristige Beziehungen wichtig sind. Darauf aufbauend lässt sich nicht nur prima zusammenarbeiten, sondern sie erleichtern auch das Leben, wenn es weniger gut läuft.
- Und gewissenhaft bin ich, weil ich Qualität in einer Arbeit als schön betrachte. Die Grafiken in Präsentationen können beinahe einem Kunstwerk gleichen, das gesehen werden will. Aber ganz ehrlich: Ich will auch im Anschluss keinen Ärger haben.
Die vier Stile sind sozusagen das Ross. Doch was ist mir als Reiter wichtig?
Summa summarum fühle ich mich in allen vier Bereichen wohl. Ich kenne also die vier möglichen Pferdchen in meinem Stall. Letztlich geht es mir persönlich jedoch darum, dass Menschen zueinander kommen. Ob dies per „dominanter“ Anleitung geschieht, mit Optimismus und Emotionalität, mit Geduld und Beharrlichkeit oder langsam und vorsichtig, erscheint mir nachrangig.
Wenn Sie also selbst nach der Analyse von Mitarbeiter*innen vor der Frage stehen, um was es einer bestimmten Person wirklich geht: Vielleicht bringen Sie mit der Wofür-Frage ein wenig Licht ins Dunkel dieser Persönlichkeit.
 Michael Hübler
Michael Hübler