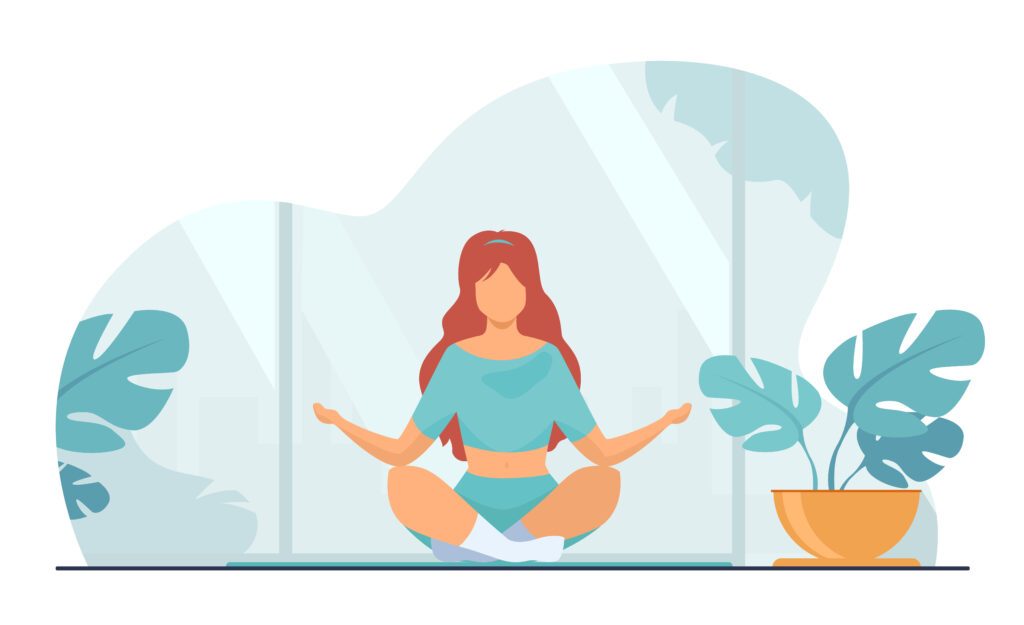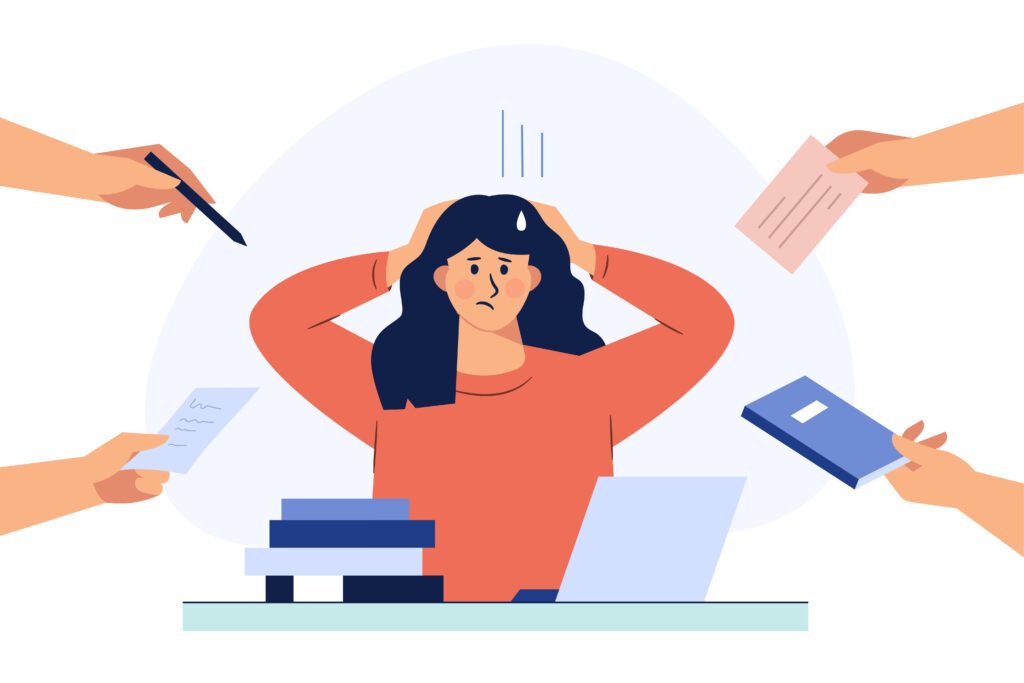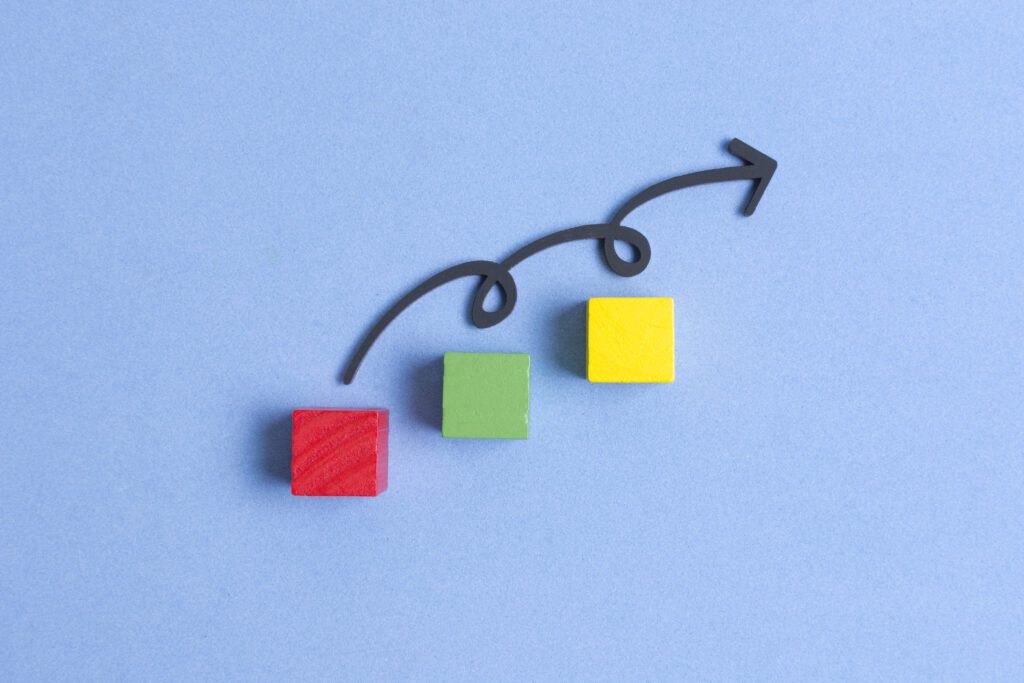
Bild von Freepik
Unser Statusdauerkampf macht uns krank
Eigentlich schien es eine gute Idee zu sein: Wir bewerten Menschen nur noch nach ihrer Leistung. Dann fallen alle andere Faktoren, bspw. das Geschlecht, die sexuelle Orientierung oder Herkunft einfach weg. Dann heißt es: Gut ist, wer gut ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Befeuert durch digitale Medien und die dadurch stattfindenden Dauervergleiche anhand tatsächlicher oder imaginärer Ranglisten entstand jedoch über die letzten Jahrzehnte ein Dauerdruck und daraus entstehend eine stetige Abgrenzung voneinander mit Geld als der Vergleichswährung Nummer 1: Wer reich ist, hat offensichtlich viel geleistet, sich mehr als andere angestrengt, kann sich um seine Fitness und Schönheit kümmern, sich gut ernähren, usw. Diese Vergleiche nehmen nie ein Ende, weil es immer irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der besser, reicher oder schöner ist als ich. Es gibt also immer etwas zu tun. Strengen wir uns an.
Folglich geht es mittlerweile weniger darum, mit wem ich etwas gemeinsam habe, sondern von wem ich mich im Sinne eines Abwärtsvergleichs positiv oder im Sinne eines Aufwärtsvergeichs negativ abgrenzen kann. Schlechte Zeiten also für die Suche nach etwas Gemeinsamem und damit auch für Solidarität.
Für solche Dauervergleiche ist das menschliche Gehirn nicht angelegt. Als Jäger und Sammler, die wir die meiste Zeit unserer Entwicklungsgeschichte waren, ist unser Gehirn immer noch auf Stress-Sprints angelegt und nicht auf Dauerstress. Ein Jäger musste sich nur selten in seinem Leben mit anderen vergleichen. Seine soziale Bezugsgruppe war überschaubar. Die heutigen Jäger*innen nach Schönheit, Perfektionismus, Höchstleistungen, grandiosen Urlaubserlebnissen und Symbolen des Reichtums können sich potentiell rund um die Uhr mit anderen messen. Zudem gilt im Internet das Diktat der Aufmerksamkeit: Nur wer sich mit etwas noch Extremerem als Gestern hervortut, wird wahrgenommen und bekommt die erhofften Klicks und Likes. Da muss es dann schon mal das Blattgold auf dem Steak sein oder besonders provokante Überschriften wie bspw. „Work Life Balance ist Bullsh*t“.
Nun könnten wir uns sagen: Warum vergleichen sich Handwerker- oder Krankenpfleger*innen mit den Schönen und Reichen in unserer Gesellschaft? Geld ist schließlich nur ein Aspekt, um glücklich zu sein. Es gibt schließlich noch Moral, Sinnhaftigkeit oder das soziale Umfeld als ergänzende Währungen. Und tatsächlich werden viele sinnhafte Berufe schlechter bezahlt als vermeintlich sinnlose. Ob sinnlose Berufe besser bezahlt werden, weil sie sinnlos sind oder sinnhafte Berufe ein höheres Gehalt nicht nötig machen sei dahin gestellt. Dummerweise funken in unserem spätmodernen Gehirn sowohl moralische Aktivitäten als auch ein hoher (potentieller) Verdienst in den gleichen Bereichen. Anders formuliert: Unser Gehirn rechnet jede Belohnung in Geld um (Vgl. Hasler, S. 48). Und da sich Einkommen messen lässt, Moral, Sinnhaftigkeit und eine gute Bindung im Team jedoch nicht, liegt es auf der Hand was verglichen wird und was nicht. Wir können uns daher sagen, dass uns das alles nichts angeht. Ärgern tun wir uns dennoch, dass jemand anders viel mehr als wir verdient. Für die einen mag das ein Ansporn sein, es auch noch bspw. als Influencer zu schaffen. Für die anderen erscheint es utopisch. Stress bedeutet dieser Statusvergleich jedoch für alle, die sich darauf einlassen.
Was hilft gegen Dauerstatusstress
1. Die Akzeptanz von Hierarchien und Regeln
Als unsere Jäger- und Sammlerkultur sich in eine Kriegskultur verwandelte, indem verschiedene Stämme um Territorien kämpften, wurde es wichtig, innere Fehden zu deckeln, um sich gegen die äußeren Feinde zu wappnen. Solche inneren Machtkämpfe wurden u.a. mit Hierarchien befriedet. Tatsächlich kann die Akzeptanz von Hierarchien den inneren Dauerstatusstress reduzieren: Wenn ich akzeptiere, dass andere mehr können und mich entsprechend unterordne, strebe ich nicht andauernd nach Höherem.
Das gleiche gilt für Regeln. Um mit den Worten eines Seminarteilnehmers zu sprechen: Wer sich als Mitarbeiter auf den öffentlichen Dienst einlässt, sollte wissen, dass es hier bestimmte Regeln gibt – was freilich auch für andere Bereiche und Branchen gilt – und sich entsprechend darauf einlassen. Wenn auch hier wie an vielen Orten ein Umbruch stattfindet, bedeutet Verwaltung immer noch, den Ablauf bestimmter Prozesse nicht allzu kreativ auszulegen. Ich ordne mich also unter und akzeptiere die Hierarchien und Regeln.
Anders formuliert: Es gibt eine Zeit zu kämpfen und es gibt eine Zeit, sich auszuruhen, indem ich mich mit der Welt arrangiere.
2. Eine gute Balance zwischen Vergleichen nach oben und unten
Ein Vergleich nach oben kann zwar unsere Leistungsmotivation steigern, Zufriedenheit und Entspannung schafft er jedoch nicht. Ein solcher Motivationsvergleich mag in normalen Zeiten sinnvoll sein. In Krisenzeiten, in denen es darum geht, schwierige Situationen resilient auszuhalten, ist es hilfreicher, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben.
Hierzu ist es besonders wichtig, sich mit den passenden Menschen zu vergleichen. Als ich vor 17 Jahren selbständig wurde, begann auch für mich die große Zeit der Vergleiche. In meiner Anfangszeit gab es quasi keinen Keynote-Speaker auf Youtube, der schlechter war als ich. Doch nach und nach merkte ich, dass die großen Redner*innen idR. zu einem Thema immer das gleiche erzählten, immer und immer wieder, mit genau den gleichen Worten. Wollte ich dahin? Ich selber interessiere mich für so viele verschiedene Themen – was den Leser*innen meines Blogs vermutlich schon aufgefallen ist :-). Zudem realisierte ich ach einigen Jahren, dass ich Reden halten kann, dass mein Herz jedoch für Führungstrainings und Teambegleitungen in kleinen Gruppen schlägt. Warum sollte ich mich also mit großen Redner*innen vergleichen. Inspiration ja, Vergleich nein.
Entsprechend stellt sich auch bei anderen die Frage: Mit wem soll ich mich vergleichen, um glücklich zu werden? Es herrscht zwar bei uns das Mantra des amerikanischen „Pursuit of Happiness“ vor, das besagt, dass jede*r alles werden kann. Insbesondere junge Menschen wachsen heutzutage oft mit dem Glauben auf, dass sie sich nur anstrengen müssen, um es zu schaffen. Die eingangs beschriebene Verschiebung von persönlichen Faktoren zur Leistung unterstützt diese Dynamik. Dennoch kann jeder Mensch immer noch selbst entscheiden, mit wem er sich aufgrund seines Charakters, seiner Kompetenzen und seiner Herkunft wirklich vergleichen will, um glücklich zu werden. Solche Vergleiche im Rahmen der eigenen sozialen Gruppe führen wiederum zu mehr Nähe anstatt zu Abgrenzungen. Wer beständig nach Höherem strebt, möchte sich aus seiner Gruppe entfernen und aufsteigen. Wer einen bestimmten Status akzeptiert, grenzt sich zu Gruppen mit einem höheren Status ab und bekennt sich damit solidarisch mit seiner eigenen Statusgruppe.
3. Vergleiche verweigern
Wir können heutzutage dank der Digitalisierung nicht nur alles Mögliche (und Unmögliche) vergleichen, sondern auch testen: Unseren IQ, Energieverbrauch und ökologischen Fußabdruck, unsere Beliebtheit auf digitalen Medien oder auch wie begehrt wir für potentielle andere Arbeitgeber sind. Schüler*innen werden benotet. Lehrer*innen und Dozent*innen werden mittlerweile dauerevaluiert. Sich hierauf nicht einzulassen ist freilich nur bedingt möglich: Wer sich in digitalen Medien tummelt wie bspw. ich, liefert sich automatisch einem Vergleich mit anderen aus. Und wer als Dozent*in arbeitet, wird nun einmal evaluiert. Ich muss damit jedoch nicht hausieren gehen. Ich muss nicht mit meinem monatlichen Gehalt angeben. Ich muss nicht in meiner Straße damit angeben, wie teuer der Wintergarten war. Wir können uns diesem Rattenrennen auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten zumindest teilweise entziehen, indem wir dem Impuls einer stolzen Verkündung eines Erfolgs widerstehen. Ein bisschen weniger prahlen und ein wenig mehr Demut täte uns vermutlich allen gut.
4. Leistungsfreie Zonen
Leistung sollte wieder dort zum Tragen kommen, wo sie hingehört. Und zwar nur dort. Wer einen Kunden berät, sollte Leistung zeigen. Wer mit seinem Team in den Endzügen eines Projekts liegt, sollte bereit sein auch mal die „Extrameile“ zu gehen. Daneben sollte es jedoch Phasen im Arbeitsleben geben, an denen es wichtig ist zu üben, zu testen und auszuprobieren. Solche leistungsfreien Zonen dienen dem Erfahrungsaufbau und Austausch untereinander. Azubis sollten nicht sofort leisten müssen. Auch in Schulen oder Hochschulen sollte es Zeiten geben, in denen es nicht um Noten geht, sondern um die persönliche Reifung ohne Vergleiche mit anderen. Und in Mitarbeitergesprächen oder Meetings sollte es ebenfalls um einen ehrlichen Austausch gehen, ohne sich gegenseitig zu bewerten.
5. Humor als letzte Möglichkeit, sich Vergleichen zu entziehen
Humor schafft eine Distanz zu Bewertungen und reduziert damit maßgeblich den Dauerstress durch Statusvergleiche. Humor greift immer dann, wenn ich mich einer Bewertungssituation nicht entziehen kann. Es gibt immer Situationen, in denen ich Vergleichen ausgeliefert bin und Leistung zeigen muss. Und wie erwähnt sind Leistungsvergleiche nicht nur schlecht. Sie spornen uns auch zu Höchstleistungen an. Ich kann jedoch immer noch selbst entscheiden, wie ernst ich Leistungsvergleiche und Statusrankings nehme, wann ich mich dadurch motiveren lasse und wann mich allzu strenge Vergleiche zu einem inneren Schmunzeln anregen.
Literatur:
Francois Lelord – Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück
Gregor Hasler – Resilienz: Der Wir-Faktor
Pauls Pearsall – Denken Sie negativ, unterdrücken Sie Ihren Ärger und geben Sie anderen die Schuld
 Michael Hübler
Michael Hübler