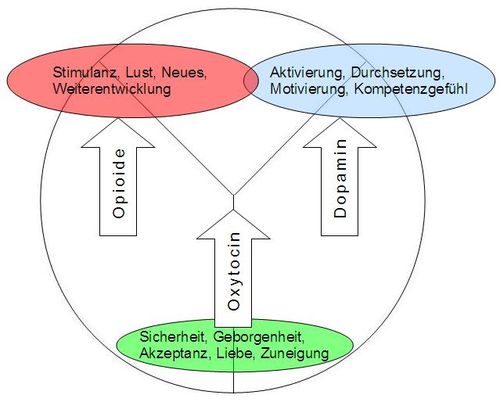Warum kooperieren Menschen?
- Wir kooperieren dann, wenn jemand zusieht. Der gute Ruf wird daran sicher keinen Schaden nehmen (Matthäus-Prinzip: Wer gibt, dem wird gegeben).
- Wir helfen anderen, um später selber mit Hilfe zu rechnen.
- Wir beschenken andere, um sie zu ‚kaufen‘ (Reziprozitätsregel).
- Wir wissen insgeheim, dass wir andere Menschen mind. ein zweites mal wiedertreffen und haben Angst vor Repressalien (Stichwort: Ultimatumspiel).
- Auch Gerüchte (ohne Fakten zu nennen) wirken: bei negativen Gerüchten sinkt die Bereitschaft, mit einem solchen Menschen zu kooperieren um 20%, bei positiven Gerüchten steigt sie dafür um 20%.
- In einer Studie an einem Getränkeautomaten ergaben sich umso höhere Spenden je stärker Augenpaare auf Bilder (anstatt einfacher Blumenverzierungen) den Spender fixierten.
- Bystander-Effekt: Wenn sich zu viele Personen um etwas kümmern sollen, macht es niemand, da dann niemand offiziell verantwortlich ist.
Fazit: Anonymität verhindert Kooperationen bzw. führt zu Egoismus. Transparenz hingegen und eine gute Reputation fördern Kooperationen.
Auf das Gebiet des Wissensmanagements übertragen bedeutet dies: Wenn in Sozialen Foren eine gewisse Transparenz über den Austausch von Wissen und dessen Konsequenz herrscht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch tatsächlich Wissen ausgetauscht wird. Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass im geheimen oftmals mehr ausgetauscht wird, wenn die Menschen Angst haben, mit ihrer Meinung daneben zu liegen oder vom Management für Äußerungen von ‚Fehlern‘ Repressalien erwarten. Für Unternehmen mit einer offenen Fehlerkultur sollte dies allerdings kein Hinderungsgrund gegenüber der Transparenz sein.
 Michael Hübler
Michael Hübler