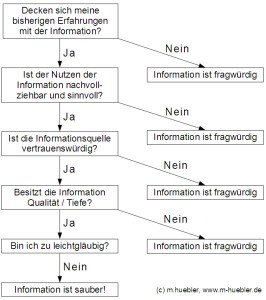Das Bedürfnis, über Generationen zu sprechen erscheint größer denn je. Während nicht nur in meinen Seminaren regelmäßig auf die Generation Z geschimpft wird, weil diese (anscheinend) nicht mehr so viel arbeiten will wie ihre Vorgänger-Generationen und damit den Industriestandort Deutschland zu gefährden scheint, wird auf der anderen Seite den „Boomern“ vorgeworfen, die Umwelt zerstört zu haben. Immerhin hat dann jede Seite ein klares Ziel für den eigenen Frust. Ist es nicht super, wenn ich weiß, dass jemand schuld ist – wahlweise an der Unterbesetzung in meinem Team oder an der Umweltverschmutzung?
Tatsächlich ist es nichts neues, dass jüngere Generationen Dinge anders sehen und machen. Das galt bereits bei den alten Griechen. Neu ist der Austausch über die digitalen Medien, auf denen sich Ältere und Jüngere treffen. Hinzu kommt nach einer langen Phase der Sorglosigkeit eine krisengebeutelte Zeit. Der Druck im Kessel ist hoch und gleichzeitig wird lautstark über die jeweilige Gegenseite lamentiert.
Nur: Bringt uns das weiter? Und: Stimmt die Generationenfrage überhaupt?
Strömungen statt Generationen
Streng genommen müssten wir nicht von Generationen sprechen, sondern von einflussreichen Strömungen innerhalb einer Generation. Ja, junge Generationen sehen vieles anders. Das gilt jedoch nur für einen kleinen Teil einer Generation. Meine Eltern waren keine Hippies, obwohl es zeitlich gepasst hätte. Sie hörten nicht Jimi Hendrix, sondern tanzten auf James Last. Und meine eigenen Kinder waren auf keiner einzigen Fridays-for-Future-Demo. Wir leben hier zwar seit Jahr und Tag ökologisch verträglich, fliegen nicht, waren noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, sind passionierte Camper, Papa fährt am liebsten mit der Bahn, wir ernähren uns flexi-bio und trennen unseren Müll nach bestem Wissen und Gewissen. Wir sind jedoch keine Öko-Aktivisten. Und: Meine Kinder gingen auf eine Realschule. Fridays-for-Future ist Thema für Gymnasiast*innen.
Und haben die Vorgängergenerationen tatsächlich den Klimawandel befeuert? Die Industrie mit Sicherheit. Aber was war mit den Umwelt-Bewegungen seit den 70-er Jahren, aus denen die Grünen hervor gingen?
Ähnlich wie in jedem Konflikt, überschätzen sich die Parteien auch in diesem hochstilisierten Generationen-Konflikt: „Ich gut – Du schlecht“ lautet die Devise. Auf Generationen übertragen heißt das:
- Wir halten den Laden am Laufen und ihr seid faul.
- Oder: Wir retten die Welt, die ihr zerstört habt.
Dabei wird leider der eigene positive Anteil überschätzt und der eigene negative Anteil unterschätzt:
- Teile älterer Generationen gingen oft zu sorglos mit sich und der Umwelt um. Manche beuteten sich über Jahrzehnte hinweg in der Arbeit selbst aus, um sich und der Familie ein Eigenheim zu leisten. Hier machen viele jüngere Menschen nicht mehr mit. Warum auch, wenn sie in Großstädten leben, es Carsharing gibt und sie sich ein Haus ohnehin nicht mehr leisten können oder wollen.
- Gleichzeitig nutzen jüngere Generationen digitale Möglichkeiten sorgloser als Generationen zuvor. Wer sich jedoch den Strom- und Wasserverbrauch bspw. von ChatGPT ansieht, könnte sein anti-grünes Wunder erleben. Und sind Klimaaktivist*innen wirklich so radikal wie sie dargestellt werden? Nur ein Beispiel: Erinnert sich noch jemand an die Republik Freies Wendland als Protest gegen die Tiefenbohrung zur Erstellung eines Atommüll-Endlagers in Gorleben? Mit eigenem Piratensender und solidarischen Botschaften u.a. in Hamburg, Hildesheim und Krefeld. Die Politik sprach von Hochverrat. Es gab sogar einen Pass, in dem stand: „Dieser Pass ist gültig, solange der Inhaber noch lachen kann“. Mir scheint, der Protest war damals radikaler als heutzutage, weil sowohl Gesellschaft als auch Medien und Politik heute insgesamt wohlwollender auf solche Protestaktionen reagieren. Damals war das absolutes Neuland. Laut Berichten wurden die Besetzer*innen mit zum Teil brutaler Härte von der Polizei davon geschleppt, geschleift und gestoßen, während Klimaaktivist*innen heute beinahe schon sanft von der Straße entfernt werden. Wenn nicht ist der Aufschrei in den digitalen Medien gegen Polizeigewalt groß.
Jede Generation hat ihre Aktivist*innen und einflussreiche Strömungen. Diese sind heute vermutlich einflussreicher als früher, da gesellschaftliche Macht heutzutage nicht nur auf finanziellen Gütern oder einflussreiche Positionen beruht, sondern auch und insbesondere über digitale Medien. Wer also als junger Mensch auf Youtube, Twitter oder Instagram viele Follower*innen um sich schart, kann Macht ausüben, wenn er will und bspw. „die CDU zerstören“. Solche Einflusssphären wirken jedoch größer als sie sind, weil viele Vertreter*innen auch der jüngeren Generation gar nicht bei Twitter sind.
Ein Fazit zur Generationen-Versöhnung
- Entspannt euch. Das kann nie schaden.
- An besagte Strömungen aus der jüngeren Generation: Überschätzt euch nicht. Es gab bei den Boomern Strömungen, die radikaler waren als ihr es seid. Und wer weiß: Vielleicht war mein Chef in den 80ern selber eine rebellische Seele? Letztlich gilt der Wahlspruch „Wir stehen alle auf den Schultern von Giganten“. Und das gilt nicht nur für die Klimabewegung, sondern für jede gesellschaftspolitische Strömung. Die Ursprünge von New Work und einer Positiven Führung gehen (mindestens) bis in die 60er Jahre zurück. Holokratie wäre nichts ohne die Ursprünge der Soziokratie. Was heute Mainstream ist, war damals Avantgarde. Ein dicker Respekt für solche Pionierleistungen ist niemals falsch.
- An die noch mächtigen Teile älterer Generationen: Hört zu. Vieles, was sich Teile der jüngeren Generation wünschen, sind vermutlich geheime eigene Wünsche: Was ist so schlimm daran, weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen? Was ist falsch daran, Spaß an und in der Arbeit zu haben? Was ist verwerflich daran, überkommene Prozesse auf deren Sinnhaftigkeit zu hinterfragen?
Ein nachhaltiger Wandel, sowohl gesellschaftlich als auch in Unternehmen, funktioniert nur gemeinsam.
 Michael Hübler
Michael Hübler