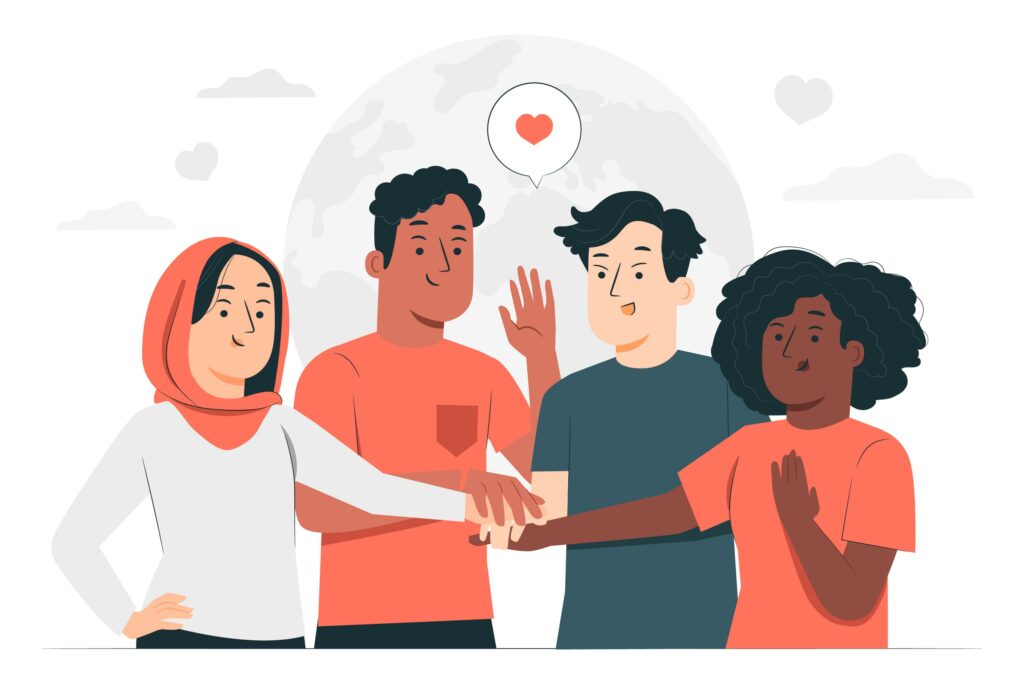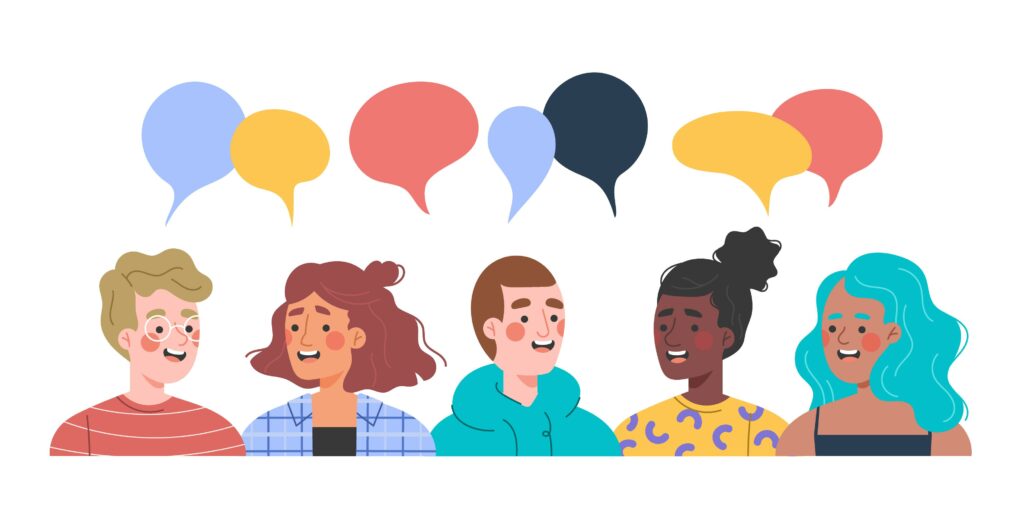Oder: Der Mensch als empathisches Wesen

Woher kommt unsere Moral? Durch äußere Regeln, die wir gelernt haben, um uns daran zu halten? Oder aufgrund innerer, emotionaler Impulse?
Große Aufklärer wie Immanuel Kant gingen paradoxerweise ähnlich wie Religionen, von denen sie sich abgrenzen wollten, von einer äußeren Macht aus: Der Mensch ist im Grunde schlecht und braucht einen moralischen Codex der Gesellschaft, um seine Triebe zu beherrschen.
Biologen wie Frans de Waal gehen von einem inneren Impuls aus, der uns als Menschen empathisch macht. Diese Empathie hat freilich auch ein Ziel: Wer sich allzu oft daneben benimmt, bekommt keine/n Partner/i und kann sich nicht fortpflanzen oder überlebt nicht ohne Kolleg*innen unter schwierigen Bedingungen. Wir leben zwar trotz Krieg in der Nachbarschaft verglichen mit der Vergangenheit in der sichersten aller Zeiten. Dennoch stecken in unserem genetischen Erbe die Grundlagen eines biologischen, unbewussten Moralverhaltens, das noch aus unsicheren Zeiten stammt.
Dieses Moralverhalten lässt sich anhand unserer Emotionen verdeutlichen:
- Ekel und Verachtung: Ekel und Verachtung fallen uns vermutlich als erstes ein, wenn wir an moralische Emotionen denken. Der Ekel bezieht sich mehr auf die Handlungen und das Verhalten anderer, bspw. bezogen auf Sauberkeit und Hygiene. Verachtung geht tiefer und bezieht sich mehr auf das Wesen meines Gegenübers: „Warum macht der nicht mehr aus sich? Warum lässt die sich so gehen?“ Während ein ekelerregendes Verhalten lediglich mein Auge beleidigt, kann ein verachtenswertes Wesen die Gemeinschaft schädigen, indem es sich auf Kosten anderer egoistisch bereichert.
- Angst: Wer einen Fehler macht, kann Angst vor dem Ausschluss aus der Gemeinschaft haben, von der er langfristig abhängig ist.
- Wut: Der Ärger hat entweder den Sinn, die eigene Angst und Trauer zu verdecken, weil diese schmerzhafter sind als Wut. Oder die Wut richtet sich gegen Abweichler*innen einer sozialen Norm.
- Trauer, Enttäuschung, Scham und Schuld: Wenn wir etwas falsch gemacht haben, werden manche von uns rot im Gesicht. Der Mensch ist das einzige Wesen mit dieser Eigenschaft. Die Röte lässt sich als offenes Schuldeingeständnis deuten, um die Situation wieder zu bereinigen. Oder wird machen uns klein und verbergen unser Gesicht hinter unseren Händen. Diese emotionalen Haltungen und Gesten lassen sich körpersprachlich unter das Gefühl der Trauer und Enttäuschung subsumieren. Wer gegen einen moralischen Codex verstieß, ist traurig darüber, dass andere wegen ihm leiden mussten und oft auch enttäuscht von sich selbst.
- Positive Emotionen: Emotionen rund um den Komplex der Freude (Begeisterung, Erleichterung, Euphorie, usw.) kommen entweder auf, wenn ein gemeinsames Ziel erreicht wurde oder eine schwierige Situation – ein Problem oder ein Konflikt – gelöst wurden.
Warum brauchen wir dennoch eine äußere Moral durch Gesetze, Verbote oder religiöse Gebote, wenn doch unser biologisches Gerüst dies im Grunde unnötig macht?
Wer in einer kleinen Gruppe lebt, weiß intuitiv, was er sich erlauben kann und was nicht. Die Abhängigkeiten von Nahrung und sozialer Unterstützung sind klar. Je größer Gruppen jedoch werden, desto unpersönlicher werden die Beziehungen. Die Unabhängigkeiten nehmen zu. Man könnte sich ja potentiell im Internet neue Freunde suchen. Die Reproduktion wird im Zuge der Überbevölkerung ohnehin von einigen Menschen in Frage gestellt. Und von einer bestimmten Nahrungskette sind wir schon lange nicht mehr abhängig. Ein „künstlicher“ Moral-Codex, der in einer kleinen Gemeinschaft meist nur bedingt notwendig ist, ist daher in einer großen Gesellschaft unumgänglich.
Und dennoch macht es einen Unterschied, ob wir davon ausgehen, dass der Mensch im Kern schlecht ist und daher moralisch erzogen werden muss – paradoxerweise von Eltern und Politiker*innen, die im Grunde auch schlecht sind. Wo soll das nur enden?
Oder ob wir davon ausgehen, dass der Mensch einen guten, emotional-empathischen Kern hat, der nach Kooperationen strebt, um diesem zusätzlich eine moralische Stütze von außen mitzugeben.
 Michael Hübler
Michael Hübler