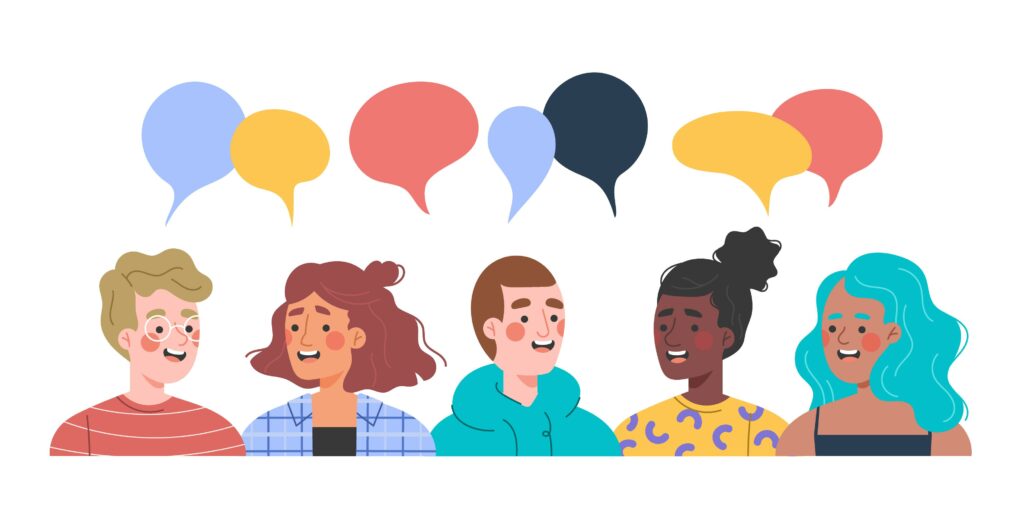
Bild von pikisuperstar auf Freepik
Das mediale Schwarz-Weiß-Denken hat Folgen
In vielen Bereichen achten wir mittlerweile auf eine sehr genaue Sprache, bspw. wenn es um Gender-Themen, den Umgang mit Minderheiten oder Migration geht. Der Mensch ist dann zuallererst Mensch und hat eben zusätzlich noch ein Handicap oder kommt aus einem anderen Land. Soweit so fortschrittlich.
In anderen Bereichen hat sich jedoch offensichtlich ein mediales Schwarz-Weiß-Denken durchgesetzt, das Konflikte neu anheizt. In der Coronazeit wurde viel von Coronaleugnern berichtet. Dabei tauchte diese Gruppe in meinem Umfeld so gut wie nicht auf. Und ich lerne sowohl als Trainer als auch privat sehr viele Menschen kennen. Ich persönlich kenne auch keinen Zero-Covid-Befürworter. Stattdessen gab es aus meiner Sicht vor allem Menschen, die das Virus als real ansahen, aber einige Maßnahmen als überzogen kritisierten. Nennen wir sie Maßnahmenkritiker, die es in den unterschiedlichsten Facetten gab. Alleine die Nutzung von Masken eröffnete eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen, von Maske auf dem Fahrrad durch Wald und Wiese, über Maske in Innenräumen ja, außen jedoch nicht, bis hin zu „Maske bringt nichts“. Ich kenne sogar Maskenverweigerer, die jedoch keine Coronaleugner sind. Und ja, es gibt komplette Impfgegner, es gibt aber auch Impfskeptiker. Es gibt sogar Menschen, die sich impfen ließen und der Impfung dennoch skeptisch gegenüber stehen. Diese kurz angerissenen Beispiele sollen zur Verdeutlichung der Komplexität genügen, da in den letzten Jahren schon genug darüber geschrieben wurde.
Aktuell geht es mit dem russischen Angriffskrieg weiter. Bereits der Begriff der Ukraine-Krise ist unscharf, da er zu sehr die Ukraine betont und den Aggressor ausblendet. Auch mit einer solchen Begrifflichkeit werden über unsere Wahrnehmung Wahrheiten geschaffen, genauso wie mit einer gender-, migrations- oder behindertenfreundlichen Sprache. Oder nennen wir sie schlicht eine menschenfreundliche Sprache. Wir sollten also viel mehr „sagen, was ist“ und weniger Abkürzungen nehmen.
Auf der anderen Seite scheint sich das Schema aus den letzten drei Jahren zu wiederholen. Was während Corona Coronaleugner waren sind jetzt Putin-Versteher. Und in großen Teilen sind tatsächlich ähnliche Gruppierungen gemeint. Die große Gemeinsamkeit besteht jedoch offensichtlich in einer grundsätzlich kritischen Haltung dem Staat und seinen Maßnahmen gegenüber, die früher nicht so vehement geäußert wurden oder vielleicht auch nicht bestanden. Es geht also weder um Corona noch um Putin, sondern um den Staat und seine Vorgehensweise. Da Politik nicht mein Hauptgebiet ist, geht es mir hier nicht um politische Lösungen, sondern um die Sprache bzw. allgemeiner die Kommunikation.
Die Digitalisierung erfordert mehr Empathie und mehr Sprachkompetenz
Dass Medien so funktionieren liegt in der Natur der Sache. Die Maxime „Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ gab es wohl schon immer, wurde in der digitalen Medienwelt lediglich extremer. Schließlich führt die digitale Globalisierung auch bei den Medien zu einem enormen Konkurrenzdruck. Leider prägt diese Denkweise unser aller Wahrnehmung und damit ebenso unsere Berufswelt, was sich auch in manchen Diskussionen auf Xing oder Linkedin verfolgen lässt. Um daraus folgende Konflikte zu vermeiden, lassen sich v.a. zwei persönliche Kompetenzen entgegen setzen: Empathie und Sprachkompetenz.
Je digitaler wir unterwegs sind, desto wichtiger wird unsere Sprachkompetenz, weil wir in einer Zusammenarbeit auf Distanz Nonverbales und Ungesagtes selbständig ergänzen müssen und daher lernen sollten, klarer zu kommunizieren. Wir brauchen daher auf der einen Seite wesentlich mehr Empathie als früher und sicherlich auch eine gute Portion Wohlwollen. Damit wird der kategorische Nörgler zu einem Menschen mit einer kritischen Haltung. Der Jammerer wir zu einem Menschen mit einer erhöhten Sensibilität. Und die Dominante wird zu einer Person mit einem starken Auftreten (ein interessantes Fallbeispiel, siehe hier).
Auf der anderen Seite brauchen wir eine genauere Sprache, die jedoch nicht nur von unserem Wortschatz abhängt, sondern zum einen von der Fähigkeit, vorwegzunehmen, wie meine Worte bei meinem Gegenüber ankommen. Zum anderen sollte ich genau wissen, was ich in der Kommunikation erreichen will. Dazu ist es hilfreich sich selbst und seine Bedürfnisse und Erwartungen gut zu kennen, ohne davon auszugehen, dass sich das erst nach und nach im Rahmen gemeinsamer Feedbackprozesse klärt. Erwartungen sollten daher so geäußert werden, dass sie genau so ankommen, wie sie gemeint sind, ohne die Möglichkeit zur Nachbesserung zu haben. Ich muss sozusagen immer davon ausgehen, dass ich nur eine Chance habe, um das mitzuteilen, was mir wirklich wichtig ist.
Nehmen wir zur Verdeutlichung ein banales Beispiel: Zwei Mitarbeiter arbeiten eng zusammen – auch auf Distanz. Mitarbeiter A schreibt an Mitarbeiter B „Wir sollten reden“. Um zu klären, wie diese schwammige Aussage bei B ankommt, gibt es seit gefühlten Uhrzeiten das Modell des 4-öhrigen Empfängers:
- Neben der Sachinformation könnte B die Nachricht als Befehl auffassen: Ruf mich an!
- Oder als Beziehungsaussage: Wir sind ein Team und sollten uns mal wieder austauschen. Oder auch: Ich bestimme, dass du mich anrufst, weil ich höher stehe als du.
- Oder als Ich-Aussage von A: Ich komme nicht weiter. Ruf mich bitte an.
In Präsenz ist eine solche Aussage schnell geklärt. Auf Distanz hängt es von der Geschichte zwischen A und B ab, ob sich daraus ein Drama entwickelt oder nicht. Ist die Geschichte negativ, wird sich B denken: Der kann mich mal, soll er doch selber anrufen, wenn er was von mir braucht. Mir geht es gut. Mit einer möglichst klaren Nachricht wäre das nicht passiert.
Was lernen wir daraus?
Die Konzepte für eine gelungene Kommunikation sind vorhanden. Das 4-Ohren-Modell ist hier nur ein kleiner, bekannter Ausschnitt daraus. Meist werden diese jedoch „nur“ an Führungskräfte vermittelt. Wünschenswert wäre es also, allen Mitarbeiter*innen Kommunikationstrainings nahezulegen, so wie früher zum Thema Zeitmanagement. Mittlerweile werden viele Kommunikationskonzepte bereits in der Schule vermittelt. Eine Auffrischung kann vermutlich dennoch nicht schaden.
 Michael Hübler
Michael Hübler