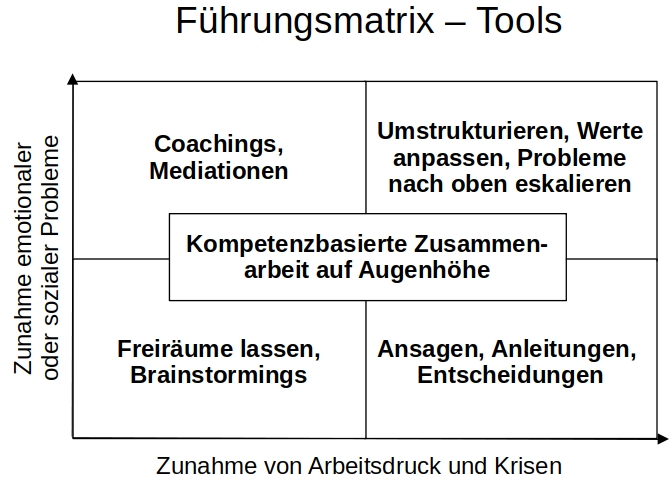Bild von Freepik
Partizipation gehört mittlerweile in vielen Unternehmen zum guten Ton. Dabei entpuppt sich das Projekt „Mehr Beteiligung“ häufig als komplizierter als gedacht. O-Ton einer Führungskraft aus einem Vortrag zum Thema Agiles Führen: „Die wollen gar nicht.“
Wie kann das sein? Sollten Mitarbeiter*innen nicht dankbar sein, mitreden zu dürfen? Und hatten sie nicht genau das jahrzehntelang eingefordert?
Es ist wie meist etwas schwieriger als es oberflächlich erscheint. Ja, das Motiv der Gestaltung oder besser Mit-Gestaltung ist in uns Menschen angelegt. Doch das Thema hat eine Geschichte: Wer jahrelang wollte, aber nicht durfte, will eines Tages nicht mehr, wenn er soll. Denn oft geht es gar nicht mehr um ein Endlich-Dürfen, sondern um ein Sollen oder Müssen. Und damit sind wir bei einem systemischen Problem angelangt, das Führungskräfte alleine nicht lösen können, jedoch verstehen sollten: Wenn Arbeit nur noch funktioniert, wenn Mitarbeiter*innen Dinge erledigen, die ursprünglich nicht in ihrem Bereich lagen, ist Partizipation eben nicht mehr freiwillig und stößt entsprechend schnell auf Widerwillen. Ein prominentes Beispiel sind Putzkräfte, die ihre Putzmittel selber besorgen „dürfen“ und sich das Unternehmen wundert, dass sie darüber nicht begeistert sind.
Nehmen wir zur Vertiefung ein Team aus 10 Personen, dessen typische Struktur aus einer Teamleitung und 9 Mitarbeiter*innen besteht. Die Teamleitung wiederum kann nicht zu 100% Aufgaben als Teamleitung übernehmen. Zum einen muss sie idR. auch Fachaufgaben übernehmen. Zum anderen ist sie mal krank oder geht in Urlaub. Rein faktisch ist das restliche Team also entweder zeitweilig führungslos, was für ein gutes Team kein Problem darstellen sollte. Oder es braucht eine Vertretung, eine stellvertretende Führungskraft bzw. ganz allgemein andere Teammitglieder, die zum Teil Führungsaufgaben erledigen.
Zweiteres wollen jedoch viele Mitarbeiter*innen nicht übernehmen. Die typische Gegenfrage lautet: „Bekomme ich dafür mehr Geld?“ Ungeachtet der Tatsache, dass dafür meist kein Geld zur Verfügung steht, reagieren viele Führungskräfte auf diese Frage empört, als wäre mehr Verantwortung bereits Belohnung genug. Doch wie unverschämt ist die Nachfrage wirklich?
Systemisch betrachtet schaut es doch so aus: Hätte die Teamleitung weniger Fachaufgaben zu erledigen, bräuchte sie keine Stellvertreter*innen. Zudem hat eine Teamleitung idR. tatsächlich nicht nur mehr Verantwortung, sondern bekommt auch mehr Geld. Ist die Frage nach einer höheren Entlohnung als universelles Zeichen der Anerkennung da so verwunderlich?
Was könnte es stattdessen geben, wenn schon kein Geld vorhanden ist? In meinen Seminaren sitzen regelmäßig stellvertretende Führungskräfte. Für diese Menschen ist Weiterbildung inklusive ein wenig Auszeit und gutem Essen auf jeden Fall eine Anerkennung ihrer Leistung. Wir dürfen nicht vergessen: Es geht immer um das symbolische Gesamtpaket. Auch andere Seminare können eine positive Wirkung haben, sollten jedoch eine logische Verbindung zur Tätigkeit haben. Auch der Ausblick auf einen späteren Aufstieg kann ein Anreiz sein, wenn dieser realistisch ist. Oder aber, es werden Teamvents oder Teamentwicklungs-Workshops für alle angeboten. Überhaupt ist die Belohnung des gesamten Teams für die Bindung sinnvoller als individuelle Angebote. Dies passiert relativ selten, wird jedoch aus meiner Erfahrung extrem dankbar angenommen. Auch Trainer-Sicht halte ich es jedoch für extrem wichtig, den Austausch- und Spaß-Faktor hier nicht zu kurz kommen zu lassen.
Wer sich dergestalt um die Bindung seiner Mitarbeiter*innen zu sich als auch untereinander kümmert, wird mit Sicherheit die Frage nach einer höheren Entlohnung bei Mehrarbeit wesentlich seltener zu hören bekommen.
 Michael Hübler
Michael Hübler