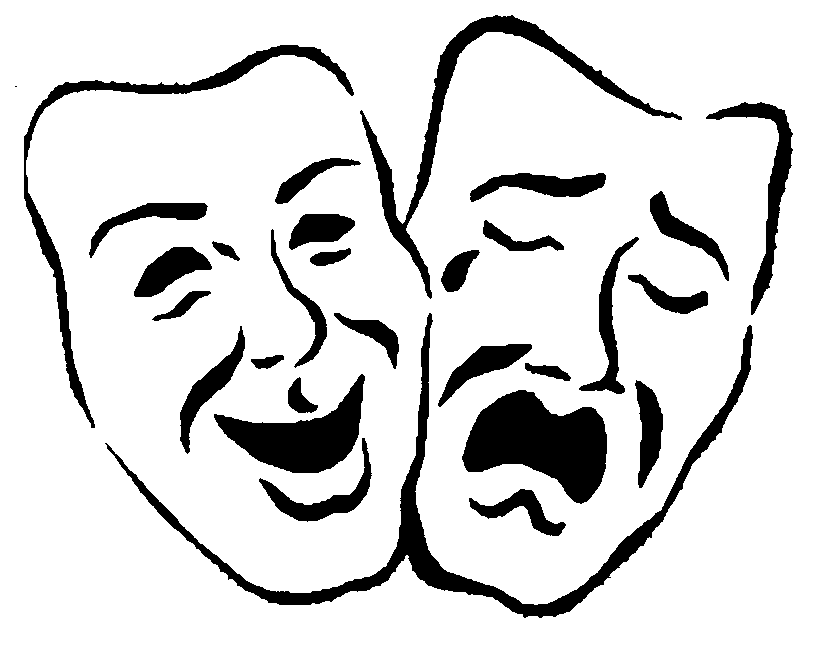
Wer eine allzu idealistische Sichtweise im Leben verfolgt, ist oft nahe dran an einer Tragödie: „Alles könnte wunderbar sein, wenn es nur nicht so schlimm wäre. Ich könnte eine perfekte Arbeit leisten, wenn mein Team vollständig wäre. Ich könnte besser führen, wenn meine Mitarbeiter*innen motivierter wären. Ich würde mit dem Projekt rechtzeitig fertig werden, wenn ich genügend Ressourcen hätte.“
Einem Ideal zu folgen ist ehrenhaft und löblich, doch leider oft wahnsinnig frustrierend, weil es in der Wirklichkeit immer anders läuft als in der Theorie. Sich an Idealen zu orientieren ist sinnvoll, um die Welt zu verändern. Daran festzuhalten endet jedoch häufig tragisch. Es macht die Menschen uneinsichtig, wütend und bisweilen sogar handlungsunfähig: „Wenn ich meine Ideale nicht erreiche, mache ich lieber gar nichts. Dann kann mir wenigstens niemand vorwerfen, ich hätte mich verkauft.“ Wenn das keine Tragödie ist?
Tatsächlich wirken Idealisten oft verbissen. Sich mit weniger als dem eigenen Ideal zufrieden zu geben, fällt manchen Menschen offensichtlich schwer. In meinen Führungstrainings kommen ab und an Fälle zur Sprache, in denen Mitarbeiter*innen entweder befördert werden oder – je nach Option – kündigen oder nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Dass diese Menschen Idealisten sind, scheint auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Das Unvermögen, sich mit Realitäten zu arrangieren ist jedoch klassisch für extreme Idealist*innen.
Komödiant*innen arbeiten mit Umständen, die so sind, wie sie sind: Wenn du auf einer Bananenschale ausrutscht, mach’ wenigstens eine gute Figur. Zum Lachen ist es so oder so. Siegen müssen wir wohl kaum lernen. Besser wäre es zu lernen, wie wir mit Humor und Würde wieder aufstehen. Wenn also ein Kollege kündigt, eine Kollegin schwanger wird, eine Krankheitswelle um sich greift oder ein Kunde abspringt, könnten wir dies als Tragödie betrachten oder als Komödie, indem wir unsere idealistischen Ziele über Bord werfen und auf Improvisation umschalten. Komödiant*innen lachen, wenn es bereits nichts mehr zu lachen gibt.
Tragödien werden durch die Hegelsche Maxime der Bestimmung des Seins durch das Bewusstsein bestimmt: Wenn Sie als Führungskraft nur intensiv genug daran arbeiten, ein System zu verändern, wird langfristig alles gut. Dass es jedoch in jedem System eine Menge Gegenspieler*innen gibt, die anderer Meinung sind, macht die Sache kompliziert.
Komödien werden durch die Marxsche Maxime der Bestimmung des Bewusstseins durch das Sein bestimmt: Systeme lassen sich nur mühsam verändern. Machen wir das Beste daraus. Das bedeutet nicht – Marx würde sich ansonsten im Grab umdrehen – nicht zu kämpfen. Auf der Basis der Realisierung eines Systems kann immer noch verhandelt werden. Allerdings Schritt für Schritt.
In der Realität brauchen Sie freilich ein wenig von beidem:
- Idealistische Ziele helfen dabei, die Welt zu verbessern. Wir sollten es jedoch nicht übertreiben, weil ansonsten die Gefahr besteht, die Gegenseite zu einem trotzigen, noch opponenterem Verhalten zu animieren. Ideale sind Orientierungen, die in der Realität vermutlich niemals zu 100% umsetzbar sind. Wäre das der Fall, hieße das Ergebnis Diktatur.
- Materialistische Vorgehensweisen helfen Ihnen dabei, das Beste aus einer schwer veränderbaren Welt zu machen, um nicht verrückt zu werden. Systemische Bedingungen, insbesondere andere Meinungen werden als gegeben akzeptiert, um gemeinsam iterativ in Verhandlungsprozesse zu gehen.
Verkürzt lässt sich also festhalten:
- Idealist*innen nehmen sich selbst ernst. Tragische Idealisten nehmen sich zu ernst.
- Materialist*innen nehmen die Welt ernst. Komödiantische Materialist*innen lassen sich dennoch ein Lachen darüber nicht nehmen.
Dabei könnte es durchaus passieren, dass Systeme tatsächlich verändert werden, wenn wir sie nicht allzu ernst nehmen. Kein Wunder, dass Diktatoren vor Humoristen am meisten Angst haben.
Wie also blicken Sie auf die Welt? Eher als Tragödie oder als Komödie? Wie ernst müssen Sie sein, um ernst genommen zu werden? Und wie viel Humor verträgt das System, in dem Sie arbeiten?
Siehe auch: Auswirkungen von Idealismus versus Materialismus auf Seminare
Quellen:
https://www.derstandard.at/story/2000010210241/lachen-ist-opposition (externer Link)
Robert Pfaller: Wofür es sich zu leben lohnt. Fischer Verlag
 Michael Hübler
Michael Hübler