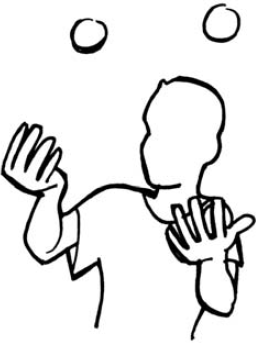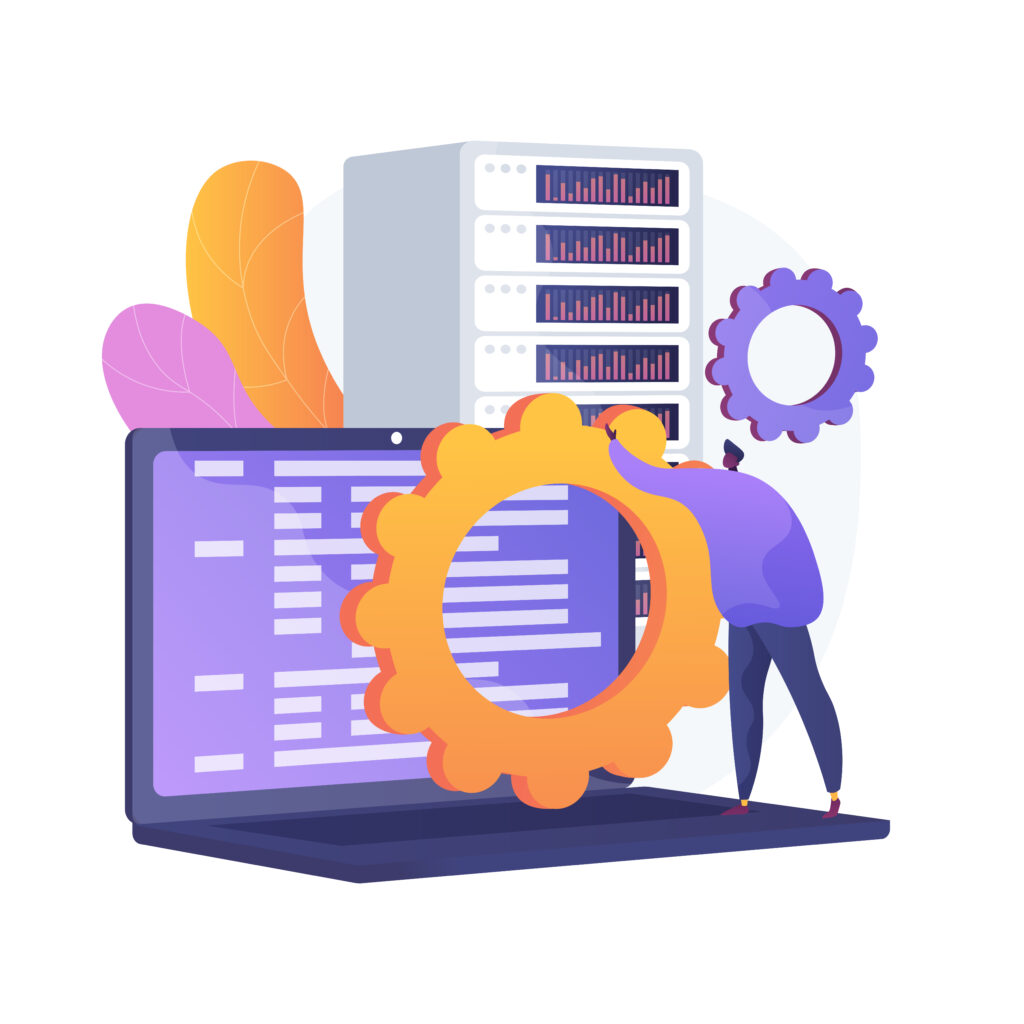
Wir leben zwar nicht im Nationalsozialismus, der Grund für Theodor Adorno war, über diese Frage nachzudenken. Dennoch lohnt es sich, auch in unserer Zeit darüber zu philosophieren. Anlass für mich sind Inhouse-Seminare im öffentlichen Dienst, in denen es beinahe jedes mal um die Frage geht, wie viel Einfluss Führungskräfte überhaupt haben in einem trägen bürokratischen System, das zudem von politischen Entscheidungen geprägt ist. Auf der anderen Seite nimmt das Lamentieren von Bürger- und Mitarbeiter/innen über Missstände immer mehr zu, obwohl früher mit Sicherheit nicht alles besser war. Viele Menschen haben offensichtlich das Gefühl, in einem mehr oder weniger schwierigen System zu leben.
Letzter Auslöser für mich, über ein gutes Leben im falschen nachzudenken war der Film „Der Passfälscher“, in dem sich ein junger jüdischer Passfälscher in der Nazizeit mit Sorglosigkeit und Frechheit immer wieder aus scheinbar ausweglosen Situationen heraus manövriert und entgegen aller Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu vielen anderen überlebt. Der Film ist aktuell (Stand 18.05.2024) bei Arte zu sehen. Die Hauptfigur des Films, Cioma Schönhaus, ließe sich wohl als Trickster bezeichnen. Die Figur ist nicht nur positiv belegt. Cioma bringt seine Mitmenschen mit seiner Sorglosigkeit durchaus in Bedrängnis, was v.a. für diejenigen gefährlich ist, die die Gabe nicht mitbringen, sich schlagfertig aus kritischen Situationen herauszuquatschen. Gleichzeitig fälscht er über 300 Pässe und verschafft damit all diesen Menschen eine Überlebenschance. Auch wenn er seine ersten Pässe mit einer gewissen Sorglosigkeit fälscht, um auszuprobieren, ob er das Fälschungshandwerk beherrscht – er wäre gerne Kunstmaler geworden – ohne sich die Konsequenzen eines verwaschenen Stempels oder anderer kleiner Fehler bewusst zu machen, ist es genau diese Haltung, die ihn dazu bringt, es zu versuchen und nach und nach immer besser zu werden. Solange, bis sein Auftraggeber ihm eines Tages sagt, dass seine aktuelle Fälschung nun endlich ein kleines Kunstwerk ist. Cioma freut sich über dieses Lob, wobei es unklar bleibt, ob er sich mehr für sich selbst freut oder wirklich die Konsequenzen seines Handelns im Blick hat, die über die Fälschung eines Passes für ihn selbst und einen Freund hinaus geht. Doch selbst wenn er sich lediglich über eine großartige Leistung freut, hat sein Handeln für viele andere Menschen positive Folgen.
Die spannendste Person in dem Film ist jedoch seine Vermieterin, die sich grundsätzlich streng an die Vorschriften hält, Cioma aber im Zweifel unterstützt. Cioma fällt es aufgrund seiner Trickster-Natur leicht, ein gutes Leben im falschen zu führen. Er scheint kaum fähig zu sein, Angst zu haben. Seiner Vermieterin jedoch fällt es sichtbar schwer. Sie hadert mit sich und entscheidet sich dennoch im entscheidenden Moment für die Menschlichkeit.
Welche Lehren können wir daraus für unseren Alltag ziehen?
- Reflexion über den eigenen Einfluss: Wir sollten uns unsere Rolle und Möglichkeiten in einem System bewusst machen. Neulich hatte ich ein Seminar für stellvertretende Führungskräfte. Als wir reflektierten, welchen Einfluss sie haben, auch wenn sie „nur“ im Vertretungsfall Entscheidungen treffen, wurde klar, dass ihr Einfluss größer ist als manche dachten. Als Vermittler*innen zwischen Management und Mitarbeiter*innen nehmen sie eine wichtige Zwischenposition ein und sind vor allem als Dolmetscher und emotionale Seelsorger tätig. Sie beraten ihre Abteilungsleitung im Umgang mit den Mitarbeiter*innen und die Mitarbeiter*innen im Umgang mit der Abteilungsleitung. Auch wenn sie Strukturen im System nicht unbedingt verändern, haben sie einen enormen Einfluss auf das System. Genauso wie Ciomas Sorglosigkeit für sein Umfeld mitreißend ist, können diese stellvertretenden Führungskräfte den Optimismus in ihren Teams hochhalten oder bei Beschwerden vermittelnd tätig werden.
- Intuitives Agieren im Jetzt: Damit dies gelingt und die Frustration über einen mangelnden Einfluss nicht überhand nimmt, ist es wichtig, nicht immer an die Konsequenzen des eigenen Handelns zu denken, sondern sich auf ein menschliches Miteinander in konkreten Begegnungen zu konzentrieren. Denken wir zu viel an die Zukunft, könnten Ängste und Sorgen überhand nehmen. Cioma beginnt mit seinen Fälschungen, obwohl er insgeheim weiß, dass ein schlecht gefälschter Pass ein Todesurteil sein kann. Er verteilt Essensmarken, ohne an seinen eigenen Hunger zu denken. Und seine Vermieterin denkt im entscheidenden Moment nicht an ihr eigenes Leben, sondern vertraut auf ihr Bauchgefühl. Auch in unserem Alltag sollte ab und an die Devise gelten nicht lange nachzudenken, sondern das zu machen, was sich richtig anfühlt. Wenn wir das beherzigen – immerhin geht es bei uns nicht um Leben oder Tod – ist auch ein gutes Leben in schwierigen Strukturen möglich.
 Michael Hübler
Michael Hübler