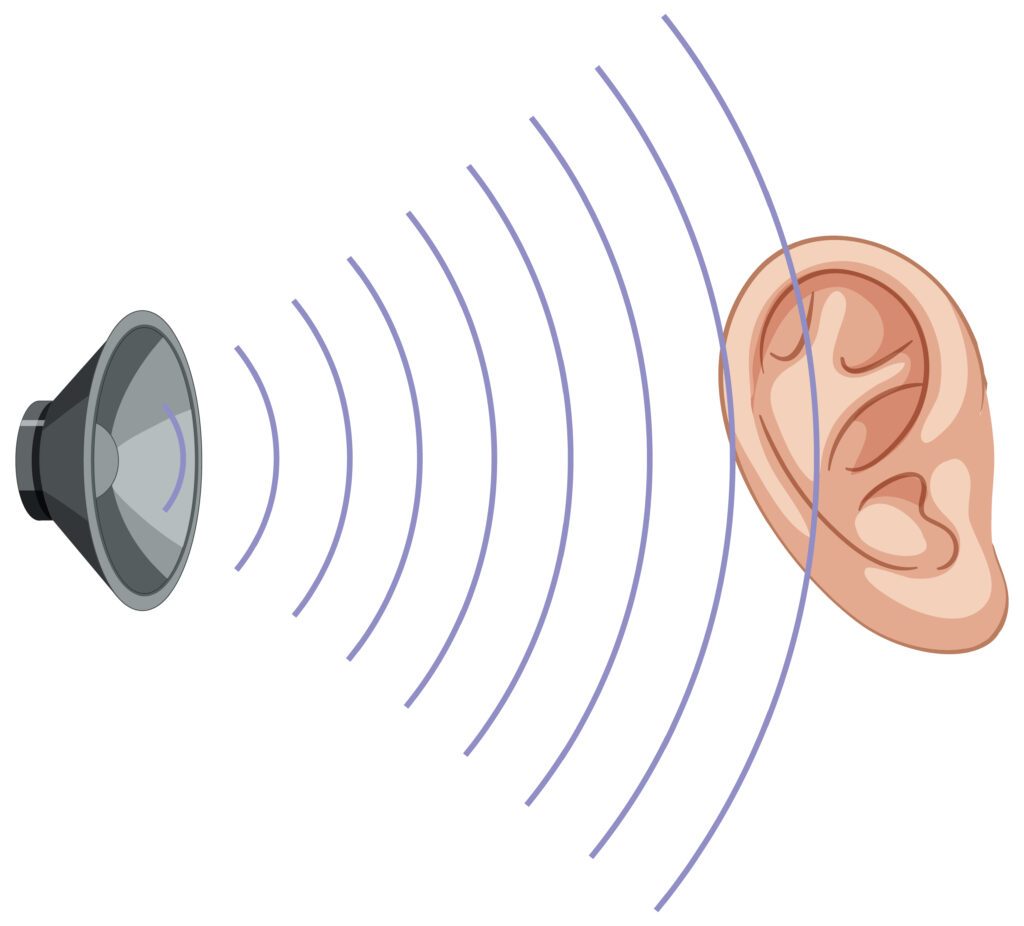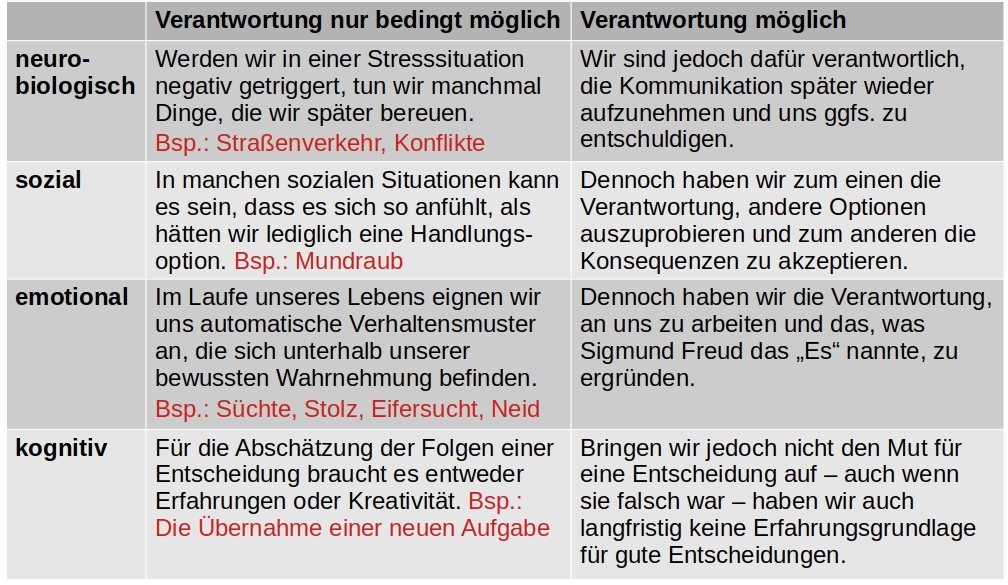Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile des jeweiligen Formats? Der Vorteil Offener Seminare ist – wie passend – die Offenheit der Teilnehmer*innen. Niemand weiß, wer gemeint ist, wenn wir über „Problemfälle“ sprechen. Es darf nach Herzenslust über die Organisationskultur gelästert werden. Das Seminar findet in einem schicken Restaurant statt – weit weg vom Arbeitsplatz. Der Begriff Bildungsurlaub kommt nicht von ungefähr. Die Inhalte sind meist hochspezifisch und daher optimal auf die Teilnehmer*innen abgestimmt, weshalb diese – sie kommen schließlich i.d.R. freiwillig – hochmotiviert sind. Klingt nach einer Menge Vorteile. Dennoch fehlt etwas, das in letzter Zeit immer wichtiger wurde: Das Thema Bindung fällt logischerweise unter den Tisch.
Inhouse-Seminare hingegen haben erst einmal eine Menge Nachteile. Sie finden aus Kosten- und/oder Motivationsgründen i.d.R. in den eigenen Räumen statt, weshalb die Teilnehmer*innen Schwierigkeiten haben voll präsent zu sein. Es kommen evtl. nicht alle Themen auf den Tisch. Stichwort: Flurfunk. Hierarchien im Seminar können ebenso eine Rolle spielen. Und oftmals sind Seminare für die gesamte Führungsriege nicht zu 100% freiwillig. Darauf muss ich mich als Trainer einstellen.
Der Spaßfaktor ist außer Haus daher meist höher. Meine Empfehlung geht dennoch ganz klar in Richtung Inhouse-Seminar, weil genau hier das Thema Bindung ganz oben steht. In Offenen Seminaren geht es um eine individuelle Wissensvermittlung und die persönliche Weiterentwicklung. Allerdings auch mit der Gefahr verbunden, dass Seminarteilnehmer*innen sich von ihrer Organisation weg entwickeln. Also Obacht, lieber Personaler*innen.
In Inhouse-Seminaren wiederum verschwimmt bestenfalls die Grenze zwischen Workshop und Organisationsentwicklung. In meinem letzten Inhouse-Seminar ging es um die Ausarbeitung eines Onboarding- und Offboardingsprozesses, um den Umgang mit Lowperformern, um einen guten Umgang mit Fehlern, um gemeinsame Werte und Führungsprinzipien für ein Leitbild und um einen guten Umgang mit Dauerbelastungen.
So gerne ich Offene Seminare gebe, aber wenn sich aus dem Seminar heraus Projektgruppen zur Weiterbearbeitung der Themen bilden, schlägt mein Trainer-Organisationsentwickler-Herz noch ein wenig höher.
 Michael Hübler
Michael Hübler