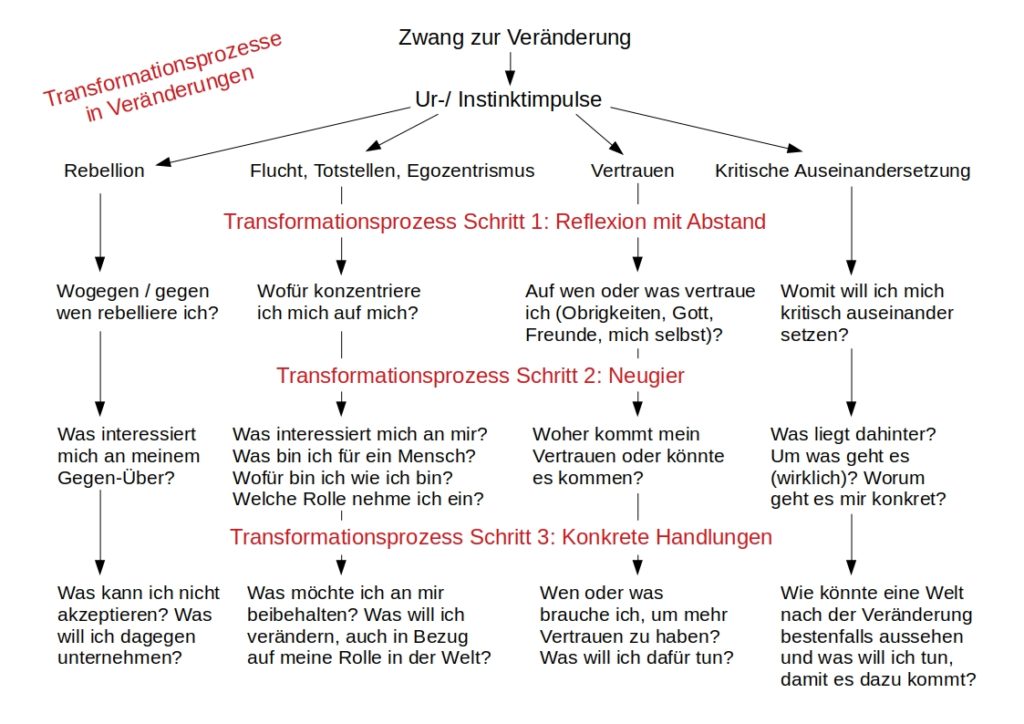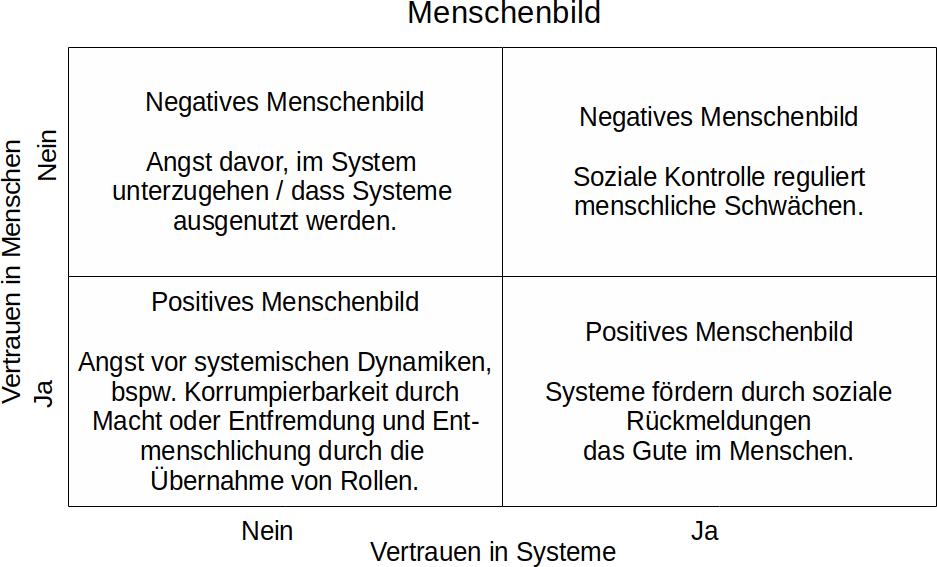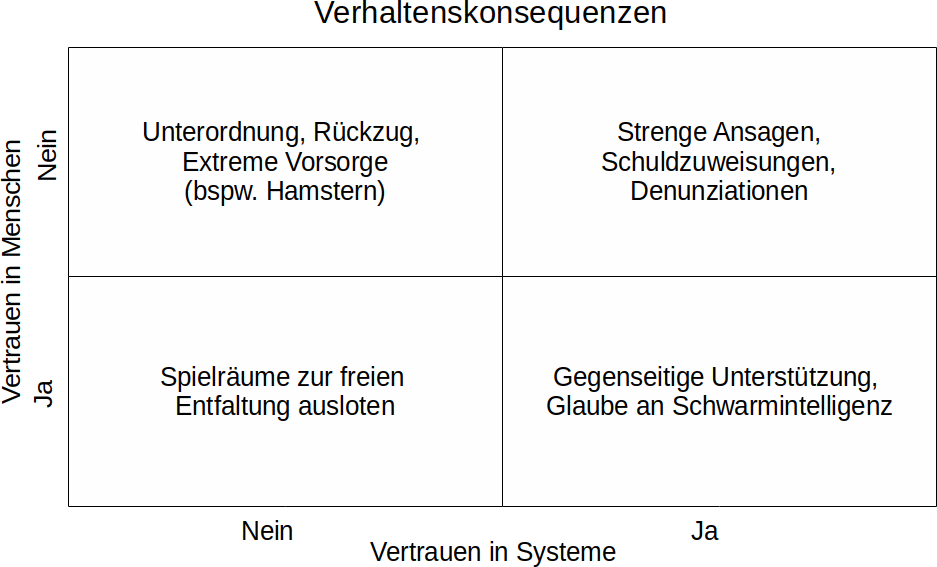Der Begriff einer psychotischen Gesellschaft geht auf Prof. Dr. Kruse zurück und wurde von Ariadne von Schirach in Buchform weiterentwickelt. Im Kern der Theorie geht es um die Entwurzelung des Menschen. Er verliert sich in Nachrichten, besitzt zu viele Möglichkeiten im Leben und kann sich nicht mehr entscheiden, was er will. Gleichzeitig fehlen ihm reale Verbindungen zu anderen Menschen. Er weiß viel, ist jedoch immer weniger an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt. Lobbyisten, die USA, China und die EU scheinen das eigene Leben mehr zu bestimmen als man selbst. Die Beteiligung der Menschen an Politik und Wirtschaft im Rahmen einer Basisdemokratie könnte ihm seine Wertigkeit zurückgeben. Dies jedoch hat heutzutage den Beigeschmack eines rechtsgerichteten Populismus. Zusätzlich nimmt die Beteiligung in vorpolitischen Gruppen ab: Kein Stammtisch mehr, kaum noch Vereinstätigkeiten. Die Diskussionen verlagern sich in den digitalen Raum, wo sie eher zu Frustrationen führen als die Möglichkeit eröffnen, intensive Gespräche zu führen. Im digitalen Raum jedoch verliert sich der Mensch. Was er sucht, findet er dort nicht: Kein Identität, keine Heimat, keinen Sinn.
Digitale Medien als Mem-Maschine
Wir leben in einer hektischen Welt, in der uns die Maßstäbe für ein lebenswertes Leben aus den Händen zu gleiten scheinen. Wir konsumieren Nachrichten aus aller Welt, um teil zu haben. Dabei verlieren wir den Überblick, was gerade für unser Leben von Bedeutung ist. Die Güte einer Nachricht spielt keine Rolle mehr. Auch nicht, ob sie wahr oder falsch ist, gut oder schlecht. Hauptsache die Nachrichtenflut reißt nicht ab. Und Hauptsache die Mitteilungen sind effektheischerisch genug, um uns emotional zu bewegen. In der Fülle der Nachrichten können jedoch keine Prioritäten mehr gesetzt werden, was für mich wirklich wichtig ist. Die digitalen Medien scheinen uns memetisch zu steuern. Dabei haben wir vergessen, dass wir Menschen die Technik erfunden haben und nicht die Maschinen sich selbst – noch nicht. Dennoch scheinen sie lebendig zu sein. Sie ernähren sich von unserer Aufmerksamkeit. Digitale Medien saugen uns wie schwarze Löcher in sich hinein und verhindern damit ein echtes Leben. Je sensationeller, umso mehr Hingucker gibt es. Hypes putschen Themen hoch, die kurze Zeit später nicht mehr relevant sind. Wir sehen das aktuell an Corona. Die Angst-, Wut-, Frustrations- und Empörungsmaschine läuft auf Hochtouren. Was bisher im „Normalmodus“ lief, scheint alsbald zu implodieren. Die Menschen ermüden. Was gestern noch aktuell war, ist es heute nicht mehr. Das Gehirn kollabiert nicht nur aufgrund der Fülle an Nachrichten, sondern auch aufgrund der Unwichtigkeit. Warum sollte ich heute etwas als wichtig beurteilen, was schon morgen nicht mehr relevant ist? Der digitale Mensch kennt zu viele Oberflächeninformationen. Er wird sogar wissen, was Trump an seinem letzten Tag im Amt gefrühstückt hat. Er weiß jedoch nicht mehr, was ihn selbst als Menschen ausmacht. Er hat den Sinn seines Daseins verloren.
Das Private im öffentlichen Raum
Dabei blicken nicht nur wir in die Medien, sondern auch die Medien in uns. Eine Tageszeitung besaß keine Kamera. Äußerungen, auch politischer Natur, wurden früher im privaten Rahmen mitgeteilt. Heute weiß die ganze Welt, was wer denkt. Das Politische wurde privat und das Private politisch. Und dank Homeoffice kann nun auch mein Chef in meine Wohnung schauen. Dabei muss ich mir gewahr sein, wie viele Informationen ich preis gebe. Ein Mensch mit 1000 Followern auf Instagram muss aufpassen, was er schreibt, um niemanden zu verärgern. Die Äußerung einer Meinung bleibt daher, bis auf Ausnahmen, die einen Shitstorm aushalten, zwangsweise oberflächlich und damit an Mainstream-Meinungen orientiert. Wir tun so, als würde das Internet offene demokratische Auseinandersetzungen fördern. Dabei ist zumindest in offenen Kommunikations-Plattformen genau das Gegenteil der Fall. Echte Auseinandersetzungen finden nach wie vor im Privaten statt.
Das ökonomische Prinzip besitzt keine natürliche Grenze
Im ökonomischen Prinzip gibt es kein gut oder böse, richtig oder falsch, gerecht oder ungerecht, sondern lediglich gewinnen oder verlieren, wobei verlieren keine echte Option ist. Das Gewinnen jedoch kennt keine Grenzen. Zwar geht es den meisten Menschen in der nordwestlichen Welt ökonomisch besser als früher. Dennoch sehen sie Tag für Tag in den Medien andere Menschen, denen es noch viel besser geht. Wer sein Glück jedoch alleinig am finanziellen Reichtum festmacht, muss scheitern. Hier gibt es keine natürliche Grenze, ab der der Mensch zufrieden sein kann. Auch Geld ist eine Mem-Maschine, die ernährt werden will. Reich zu sein macht süchtig. Es geht nicht darum, reich zu sein, sondern immer reicher zu werden. Dabei ist das Gegenteil von mehr nicht weniger, sondern genug.
Auflösung des Erfahrungs- und Begegnungsraums
In der Digitalisierung gibt es kaum eine Tiefe des emotionalen Erlebens und der Begegnung. Ich spüre nicht, was mein Gegenüber fühlt. Subjekte werden zu Objekten. Wir dürfen schauen, aber nicht mehr anfassen, zeigen, aber nicht mehr machen. Der Raum zwischen uns, der uns im realen Leben verbindet, ist lediglich ein Bildschirm. Videokonferenznutzer fragen sich häufig, warum es so ermüdend ist, einen Tag lang über Video in Kommunikation zu sein. Die Antwort ist so einfach wie komplex: Eine Videokonferenz spricht nur unser Sehen und Denken an, nicht jedoch unser Fühlen und Spüren. Als Mensch brauchen wir die körperlich spürbare Verbindung zu anderen Menschen, um unser Gegenüber einschätzen zu können und uns selbst zu verorten. Fehlt das Fühlen und Denken und damit unsere Intuition, unser körpereigenes Big-Data-System, wissen wir oft nicht, woran wir sind. Wir bekommen kein intuitives Feedback, keine Rückmeldung woran wir sind und wo wir stehen. Diese Lücken müssen wir in unserem Gehirn denkend ergänzen. Dies kann zu Unsicherheiten, Ärger, Missverständnissen, Ungeduld, Frustration oder Gerüchten führen.
Entgrenzung des zeitlichen Erlebens
Alles, was potentiell erlebbar ist, kann ich jederzeit erleben. Dies führt zum einen zu einer Überforderung, da ich auswählen muss, was genau jetzt für mich wichtig ist. Gleichzeitig führt es zu einer Beliebigkeit. Alles ist gleich wichtig, weil es gleich verfügbar ist. In einer Welt der Verknappung musste ich mich entscheiden. Jetzt kann ich mich nicht mehr entscheiden. Die Auswahl von allem zu jeder Zeit ermüdet den Menschen.
 Michael Hübler
Michael Hübler