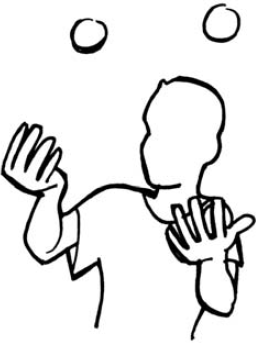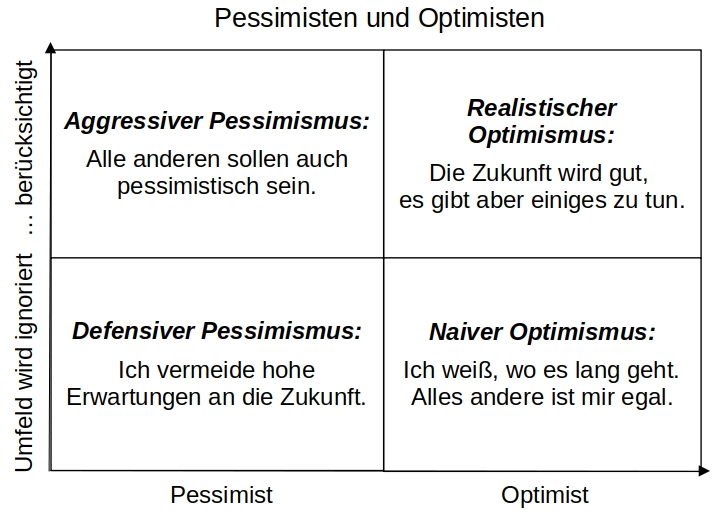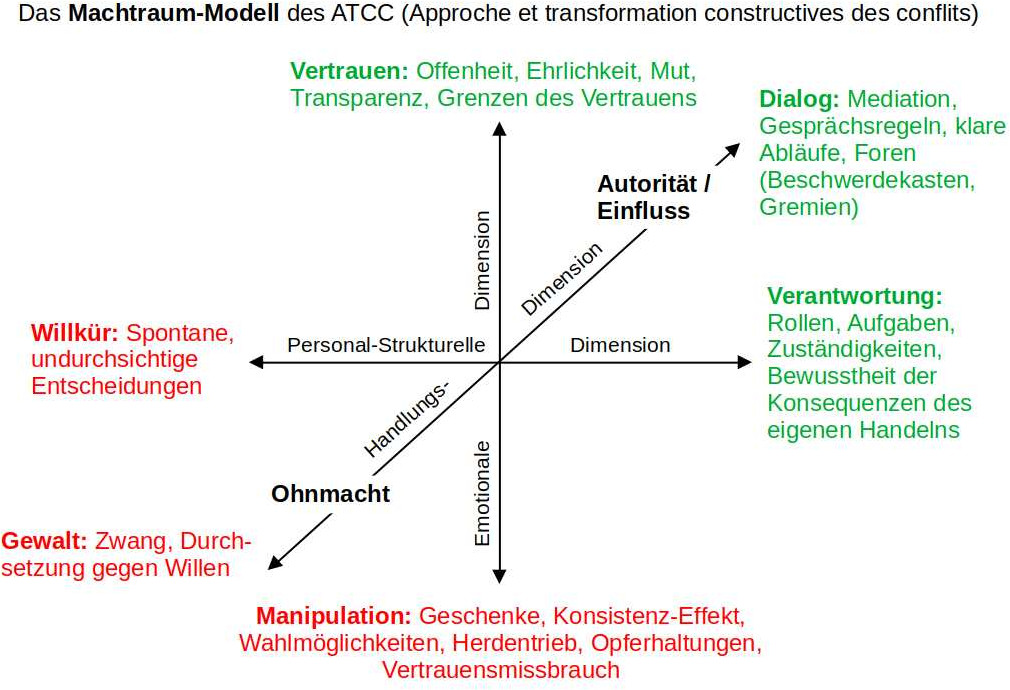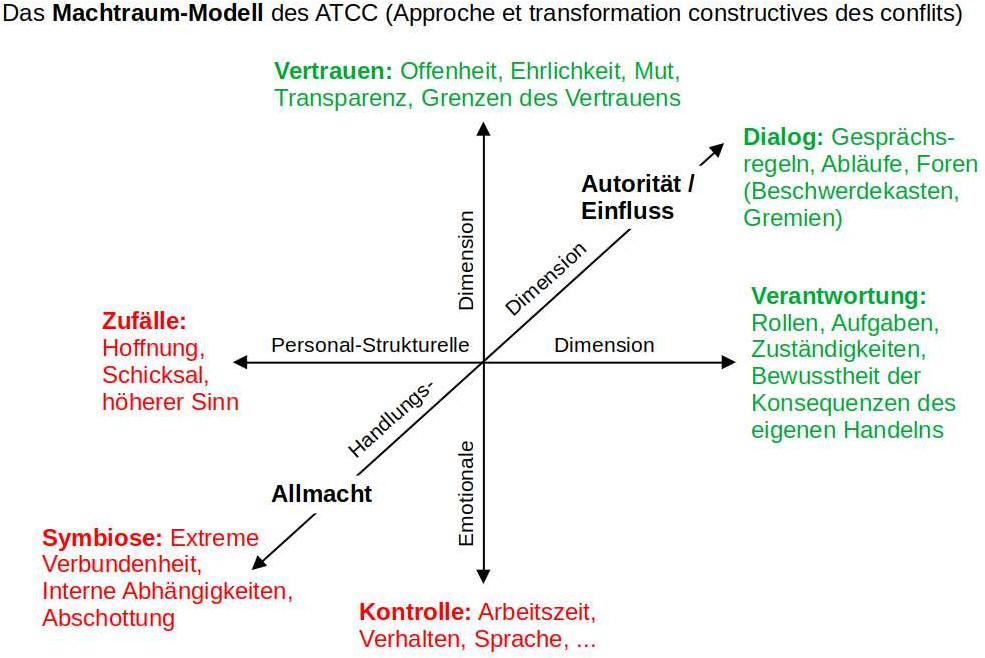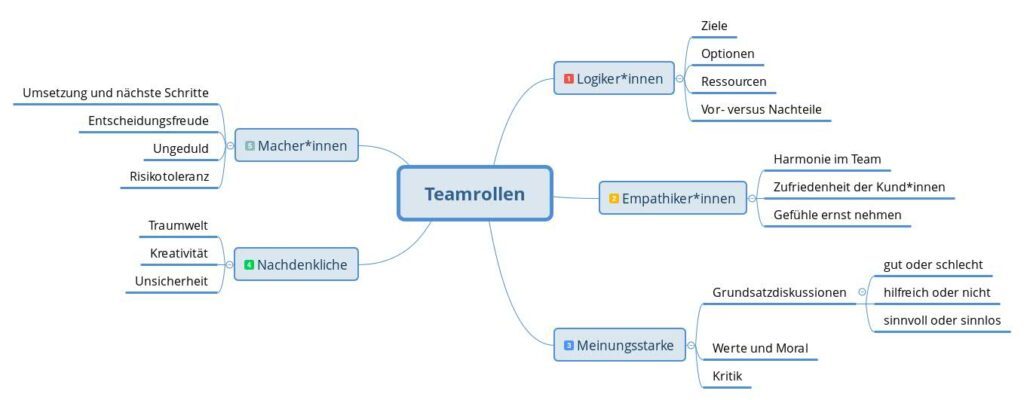Das eigene Ego zähmen
Ich gebe es zu. Ich hatte es leicht. Mit einem Abitur von 3,2 fiel es mir leicht, mich nicht auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als meine Kompetenzen durch das Ausprobieren neuer Wege und Ideen (Stichwort Kochkünste) stetig zu erweitern. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern dauert immer noch an. Wenn ich zu einem Zwei-Tages-Seminar fahre, bereite ich die ersten beiden Stunden zu 100% vor, den Rest des ersten Tages zu 80% und am Abend wird das Grundgerüst des zweiten Tags verfeinert. Hier nicht zu improvisieren und das Programm an die Bedürfnisse meiner Teilnehmer*innen anzupassen wäre respektlos.
Machen wir es in Gesprächen nicht genau so? Oder schreiben Sie sich einen Ablaufplan auf einen Zettel und beharren darauf, alles genau so zur Sprache zu bringen, wie Sie es sich vorgestellt haben, auch wenn das Gespräch eine andere Wendung nimmt? Eben.
Planen beinhaltet den Wunsch, zu agieren ohne gestört zu werden. Improvisieren jedoch bedeutet mit der Welt zu interagieren.
Nun hatten einige da draußen weniger Glück als ich und wurden mit einem großen Talent geboren, weshalb sie es zu Beginn nicht nötig hatten, zu improvisieren und damit Neues dazu zu lernen. Dies kann lange gut funktionieren. Meist ist jedoch spätestens zum Ende der Schulzeit Schluss damit. Doch dann – in der Universität oder der Schule des Lebens – sind andere Dinge gefragt. Unser geschultes (!) Ego sagt jedoch:
- Schaff’ es alleine: Wer sich gut vorbereitet, muss niemanden um Rat fragen. Fragen ist peinlich. → Schade Ego: Lernchance verpasst, zumal ein improvisiertes Lernen in der Gruppe einen großen Spaß machen kann.
- Sei perfekt: Nur die Perfekten werden geliebt. Vermeide Fehler. Plane rechtzeitig und zu 100 %. Erst dann läuft ein Projekt reibungsfrei ab. → Schade Ego: Wer immer versucht perfekt zu sein, macht nur das, was er oder sie schon kennt und lernt nichts dazu.
- Tritt niemandem auf die Füße: Es gibt dort draußen ohnehin schon so viele unverschämte Menschen. Da halte ich lieber meinen Mund, um die Harmonie in der Gruppe aufrecht zu erhalten. → Schade Ego: Wer niemandem auf die Füße treten will, hat Angst vor spontanen Ideen, die zu schnell kommen, um noch auf soziale Verträglichkeit geprüft zu werden. Und vielleicht sind manche ausgesprochenen Gedanken weniger schlimm als wir glauben.
- Hab alles im Griff: Sei souverän. Zeig keine Schwächen. Zu improvisieren kann mächtig daneben gehen. Dann lieber abwarten und noch mehr Informationen einholen. → Schade Ego: Wer souverän bleiben will, scheut sich vor wackeligen Improvisationen. Das potentielle Scheitern bringt zu viel Spannung mit.
- Sei zuverlässig: Improvisieren ist etwas für Leute, die sich nicht gut vorbereitet haben. Will ich wirklich, dass mein Umfeld mich für unzuverlässig hält? → Schade Ego: Wer immer zuverlässig sein will, orientiert sich nur noch an den Bedürfnissen anderer und verliert den Blick für die eigenen Bedürfnisse.
Wie also kann es gehen vom eigenen Ego beziehungsweise dessen antizipierter Wirkung auf andere zum Improvisationskünstler zu werden?
Üben, üben, üben
Sich sein Ego bewusst zu machen ist ein erster wichtiger Schritt. Es geht aber auch vollkommen unpsychologisch über Handlungen:
- Laden Sie Leute ein und bereiten nichts vor.
- Laden Sie Leute ein, von denen Sie denken, sie würden nicht harmonieren oder von denen Sie wissen, dass sie einen Streit miteinander hatten.
- Fahren Sie ohne Navigationsgerät mit dem Auto durch die Gegend.
- Weg mit Google-Maps. Lassen Sie sich durch eine fremde Stadt treiben und von den Läden inspirieren.
- Buchen Sie ein Flugticket auf eine Insel und lassen Sie sich dort überraschen.
- Bereiten Sie für die nächste Präsentation nur die allerwichtigsten Charts vor und füllen den Rest der geplanten Zeit mit Diskussionsfragen, deren Ergebnisse Sie elegant moderieren.
- Bestellen Sie ein Gericht, das Sie noch nie gegessen haben.
- Machen Sie im Urlaub das Gegenteil von dem, was alle machen. Alle gehen an den Strand oder besichtigen einen berühmten Dom. Sie machen eine Flusswanderung oder setzen sich in ein Cafe und beobachten das wilde Treiben vor dem Domplatz.
- Kaufen Sie ein 2-für-1-Essensgutscheinbuch, bei dem das zweite Gericht umsonst ist und probieren neue Restaurants aus.
Dieser Artikel wurde in leicht veränderter Form aus dem eBook „Wie kompetent muss ich sein?“ (externer Link) entnommen.
 Michael Hübler
Michael Hübler