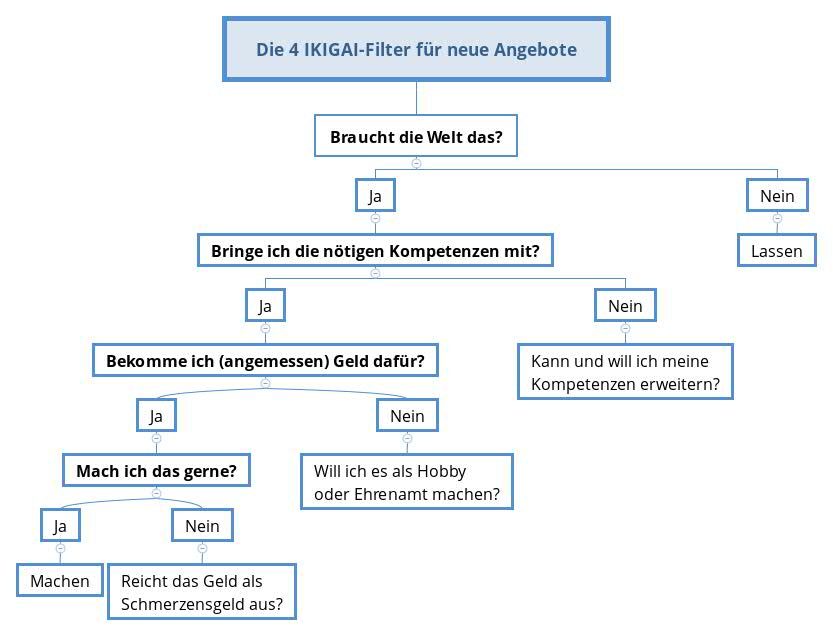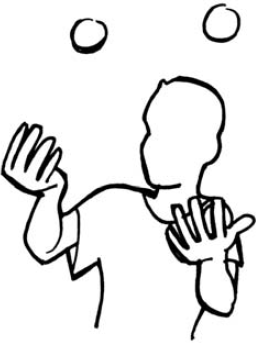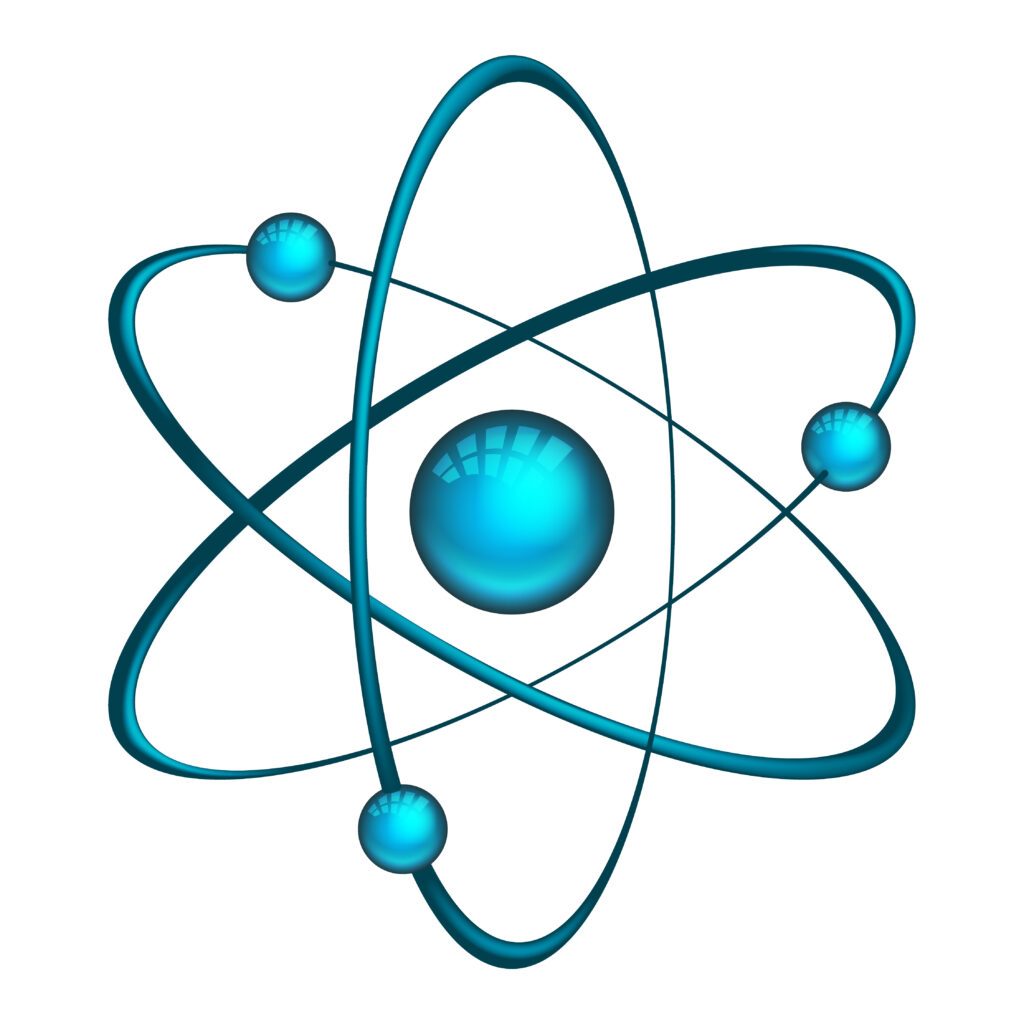
Everything, everywhere, all at once
Viele von uns waren in Filmen wie „Everything everywhere all at once“. Was als spaßige oder spleenige Actionkomödie angelegt ist, hat jedoch einen ernsten Hintergrund: Erkenntnisse aus der Quantenphysik besagen, dass auf einer subatomaren Ebene alles jederzeit stattfindet. Das wiederum ist für uns schwer vorstellbar. Wer sich jedoch intensiver mit dem Thema beschäftigt, merkt einerseits, dass es komplett logisch ist, dass alles jederzeit stattfindet und andererseits, dass wir immer noch durch und durch von der klassischen Aufklärung des Sezierens einzelner Phänomene geprägt sind, die keineswegs jederzeit alles sein können. Was also ist dran an der Quantenphysik?
Beginnen wir mit dem Gedankenexperiment um Schrödingers Katze, das der ein oder die andere vermutlich schon einmal in der Schule gehört, für eine verücktes Idee gehalten und daraufhin wieder vergessen hat – so wie ich: In einer Kiste befinden sich eine Katze, ein radioaktives Präparat, ein Detektor für die beim Zerfall erzeugte Strahlung und ein tödliches Gift, das bei Ansprechen des Detektors freigesetzt wird. Die Kiste ist allerdings so verschlossen, dass wir nicht wissen können, ab wann die Katze tot ist. Erst wenn die Kiste geöffnet wird, erkennen wir, ob sie schon tot oder noch lebendig ist. Daraus lassen sich zweierlei Erkenntnisse ziehen:1
- Solange die Kiste nicht geöffnet wird, könnte die Katze sowohl tot als auch lebendig sein.
- Erst in dem Moment des Öffnens lässt sich der Zustand der Katze feststellen, wodurch die Rolle des Beobachters auf irgendeine Weise wichtig erscheint.
In Folge wurden in den letzten Jahrzehnten eine Menge Studien durchgeführt, die alle zu ähnlichen Erkenntnissen führen: Subatomare Teilchen (bspw. ein Quarks) lassen sich erst eindeutig bestimmen, wenn sie „festgehalten“ und beobachtet werden. Bis dahin schwirren sie durch den Raum und könnten auch etwas anderes sein (bspw. ein Anti-Quarks).
Teilchen und Schattenteilchen
Gleichzeitig wurde deutlich, dass es letztlich keine tatsächlichen Elementarteilchen gibt, weil jedes Teilchen immer im Verbund mit einem anderen Teilchen (Quarks und Anti-Quarks, Protonen und Elektronen) auftritt. Die Quantenphysik spricht tatsächlich davon, dass jedes Teilchen einen Schatten hat. C. G. Jung, der Urheber der sogenannten Schattenanteile, hätte sich darüber vermutlich gefreut. Die Suche nach dem einen Elementarteilchen war bislang erfolglos. Das wiederum wusste der gesunde Menschenverstand bereits vorher. Frieden wird schließlich erst zu Frieden durch die Existenz von Krieg. Plus ist ohne Minus nicht denkbar. Freude lässt sich erst genießen durch die potentielle Möglichkeit von Trauer. Wir wüssten nicht einmal, wie wir miteinander sprechen sollten, wenn es den jeweils anderen Gegenpol nicht gäbe. Dann wäre letztlich alles neutral: Wir wären nicht gut oder schlecht gelaunt, sondern neutral. Genau das passiert auch, wenn sich Materie und Antimaterie treffen. Am Ende steht das Nicht, das sich dann logischerweise selbst mit den feinsten Messgeräten nicht mehr messen lässt.
In unseren Alltag übertragen bedeutet dies, dass nicht nur auf der subatomaren Ebene jederzeit alles möglich ist, solange niemand hinsieht und sich erst durch die Beobachtung durch eine Bewertung ein wahrnehmbarer Zustand manifestiert. Beobachten wir aus der Ferne ein Paar, das sich lautstark unterhält, könnte es ein Streit sein oder eine lebhafte, aber von Liebe durchdrungene Unterhaltung. Die beiden könnten sich schon lange kennen oder gerade eben erst begegnet sein. Erst wenn wir näher hingehen, erkennen wir, um was für eine Unterhaltung es sich handelt. Dann jedoch verändern wir bereits das Setting durch unsere subjektive Beobachtung, wodurch sich die Situation nicht mehr zu 100% objektiv erfassen lässt. Wir selbst nehmen wahr, was wir wahrnehmen wollen. Und das Paar wird sich der Beobachtung bewusst und lässt sich dadurch in einen bestimmten Zustand (Konflikt, lebhafte Auseinandersetzung, Liebesspiel, etc.) materiell „einfrieren“, obwohl zuvor evtl. verschiedene Zustände möglich waren.
Ein ähnliches Phänomen spielt sich in Organisationen ab, wenn ein Mitarbeiter, der an vielen Veränderungen herum nörgelt aus der einen Perspektive als anstrengend, aus einer anderen jedoch – er hat ja auch häufig recht mit seiner Kritik, auch wenn es niemand hören will – als wertvoller Kritiker wahrgenommen wird. Erst durch die Beobachtung bzw. Bewertung des Mitarbeiters wird sein Verhalten in Stein gemeißelt und zieht manifeste Folgen nach sich.
Frage ich in meinen Seminaren in die Runde, wer mit wem am meisten Probleme hat, zeigt sich beinahe immer: Der eine mag keine Nörgler, die nächste keine Besserwisser und der dritte kann nicht mit Jammerern. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen persönlichen Schattenanteil (oder die ganz persönliche Anti-Materie), die mich erst zu einem ganzen Menschen macht. Konkret heißt das: Fragen Sie sich, was ein Nörgler, Besserwisser, Jammerer, etc. beziehungstechnisch mit Ihnen macht und was Sie daraus lernen können.
Warum mir der Umgang mit leidenden Menschen schwer fällt
Eine Anekdote am Rande: Mir persönlich fällt der Umgang mit leidenden Charakteren schwer. Der Grund ist in meiner Kindheit zu finden. Meine Mutter hatte früher starke Migräne-Attacken, worauf wir in der Familie Rücksicht nehmen mussten. Ich durfte nicht laut sein, keine Freunde mitbringen und wir unternahmen selten Ausflüge. Dadurch lernte ich, meine Befindlichkeiten zurückzunehmen und niemandem zur Last zu fallen, wodurch sich jedoch Wut aufstaut, die irgendwann einmal raus muss oder krank macht. Oberflächlich betrachtet könnte ich nun sagen: Jammern macht mich wütend. Dabei bestand die eigentliche Unzufriedenheit darin, mein eigenes Bedürfnis anderen in einem gesunden Maß zur Last zu fallen, nicht auszuleben. Ich tat mich jahrelang schwer, fremde Hilfe anzunehmen. Erst durch die Integration meiner Anti-Materie (dem ungeliebten Jammern) habe ich die Möglichkeit, ein vollkommenerer und zufriedenerer Mensch zu werden.
Das Mindset der klassischen Aufklärung
Unser menschlicher Geist hängt leider noch am Mindset der klassischen Aufklärung. Die klassischen Naturwissenschaften gingen davon aus, dass jeder Körper für sich selbst besteht und untersucht werden kann. Diese Sezierung von Gesamtzusammenhängen führte einerseits zu vielen Erkenntnissen, verstellte jedoch andererseits den Blick darauf, was Systeme zusammen hält.
Unterstützt wird das Ganze durch den Kapitalismus:
- Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Raumschiff.
- Unterm Strich zähl’ ich.
Ebenso spielt der Heldenmythos dieser Denkweise in die Karten. Als könnten ein paar Marvelfiguren die gesamte Welt retten. Mit Schwarmintelligenz tun sich die Menschen seit jeher schwer. Kein Wunder, dass mein Buch zu diesem Thema letztes Jahr aufgrund zu schwacher Verkaufszahlen eingestampft wurde.
Wir brauchen ein neues Mindset
Die Quantenphysik legt uns nahe, uns von diesem Denken zu verabschieden, indem wir akzeptieren, dass wir alle – und insbesondere Gegenpole – miteinander verbunden sind. Die Welt um uns herum entstand nicht durch Elementarteilchen, sondern durch das Zusammenspiel von Materie und Antimaterie, von Teilchen und Schattenteilchen. Insofern werden auch wir nicht angetrieben von einzelnen (abgegrenzten) Menschen, sondern erst durch das Zusammenspiel in einem Team.
Diese Denkweise könnte weitreichende Konsequenzen haben:
- Anstatt in Bewerbungsgesprächen zu fragen, welche Kompetenzen jemand mitbringt, bietet sich die Frage an, was jemand bieten kann, um ein Team zu ergänzen.
- Anstatt Veränderungen gegen Widerstände durchzuboxen, wäre es sinnvoller, kritische Meinungen sozusagen als natürliche Anti-Materie zu akzeptieren und zu integrieren.
- Anstatt in Konflikten davon auszugehen, dass nur meine Meinung richtig ist, wäre es wichtig, sich damit anzufreunden, dass auch mein Gegenüber recht hat.
Wer sich bereits mit systemischem Denken und Mediationen auseinander setzte, erkennt hier wenig Neues. Neu ist jedoch die Erkenntnis, dass all das kein bloßes pädagogisches Schönwetter-Wunschdenken ist, sondern tief verwurzelt ist in der DNA unserer Welt.
Sollte diese Denkweise eines schönen Tages in der Gesellschaft angekommen sein, würden die Menschen vielleicht endlich verstehen, dass sie nur gemeinsam die Welt retten können, anstatt gegeneinander in Konkurrenz zu treten.
Literatur:
Lynne Haggard – The Bond. Die Wissenschaft der Verbundenheit
Hüther und Spannbauer – Verbundenheit
 Michael Hübler
Michael Hübler