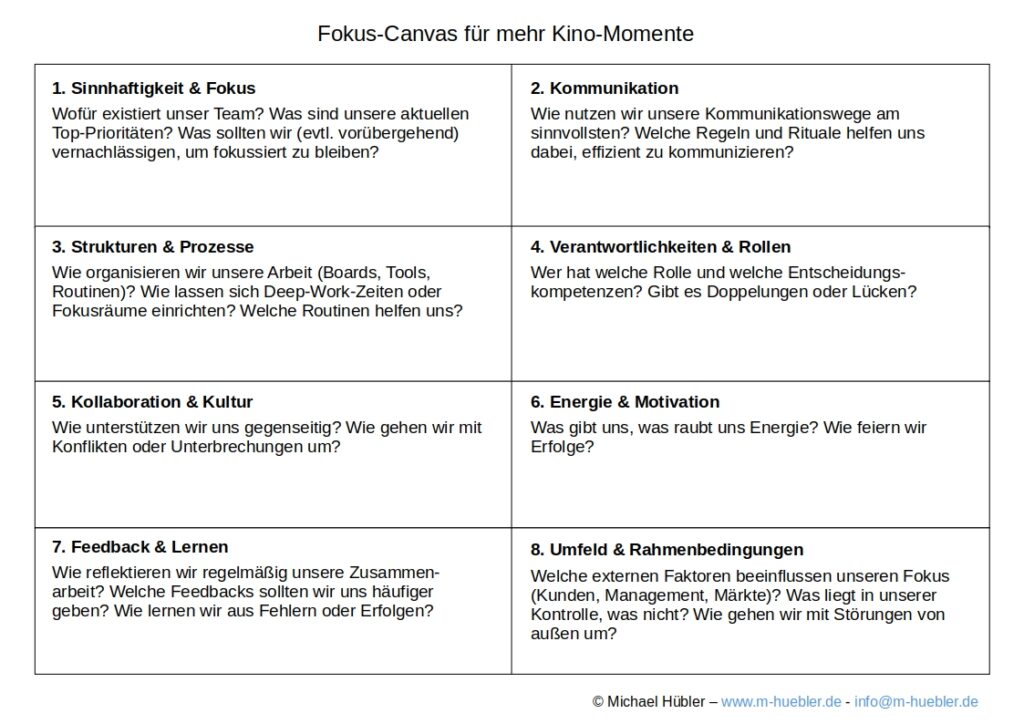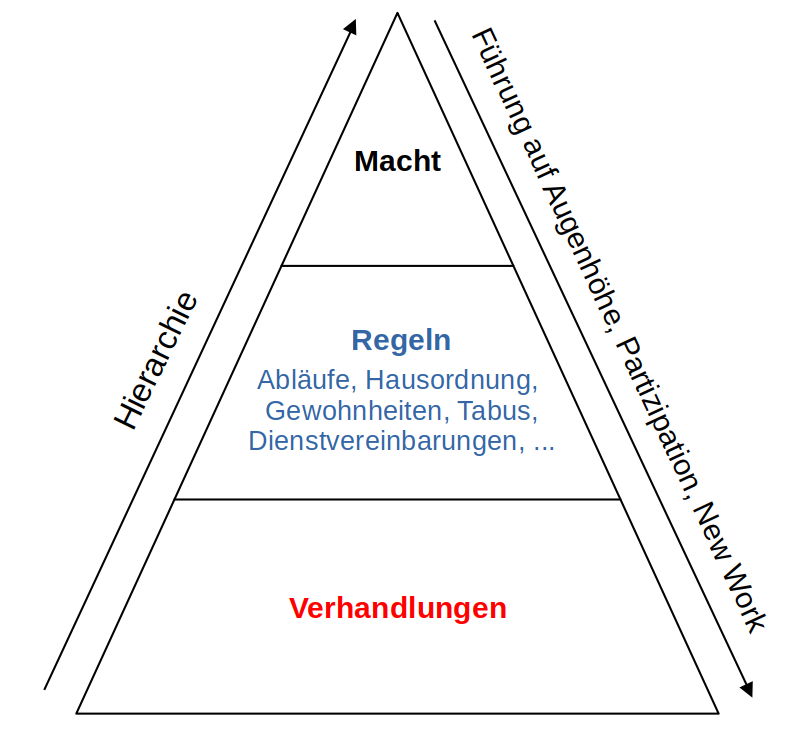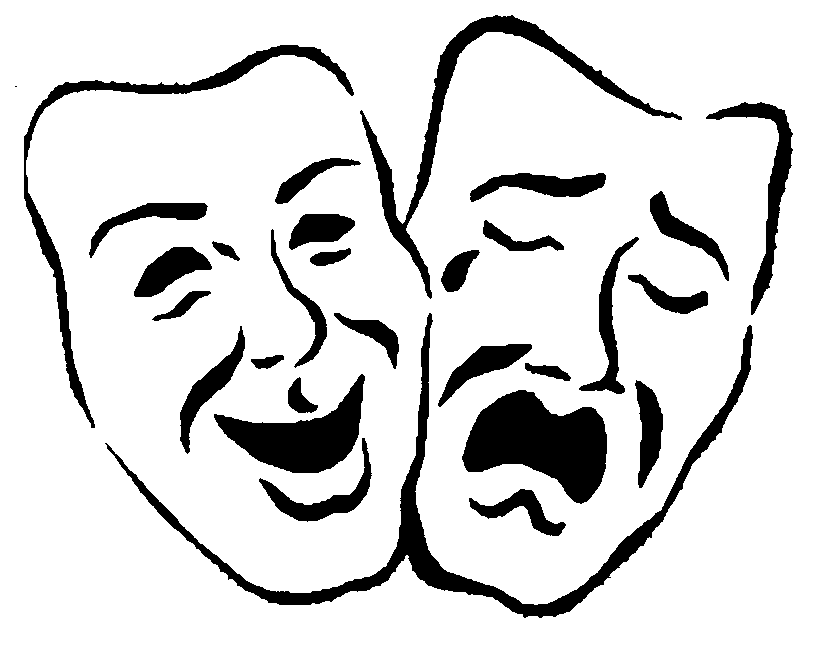https://de.freepik.com/autor/freepik
Wirkt Hoffnung vertröstend?
Während Hoffnung als zu passiv oder vertröstend empfunden werden kann, gilt ein zupackender Aktivismus gerade in Krisenzeiten als Methode der Wahl.
So sagte Greta Thunberg in ihrer berühmten Rede vor der UN 2019 („How dare you?“) sinngemäß: „Ich will nicht, dass ihr Hoffnung habt. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr handelt.“
Wer Hoffnung hat, so die Denkweise, handelt nicht. Je dringlicher jedoch eine Krise ist, desto aktiver sollten wir werden.
Auch in anderen aktivistischen Kontexten gilt diese Sichtweise, wenn Hoffnung als „Opium der Privilegierten“ kritisiert wird:
- Wer wenig zu verlieren hat, kann sich Hoffnung leisten.
- Marginalisierte Gruppen hingegen erleben, dass Hoffnung ohne Aktion leer bleibt.
→ Hoffnung gilt hier als Ersatzhandlung, um Ungerechtigkeit langfristig auszusitzen.
Ein Gegenbeispiel war der erste Wahlkampf von Barack Obama, der vielen Menschen als Hoffnungsträger galt („Yes, we can!“). Dies funktioniert allerdings langfristig nur, wenn es auch echte Veränderungen gibt. Andernfalls wird Hoffnung individualisiert.
Tatsächlich geht laut dem Hoffnungsbarometer von Dr. Andreas M. Krafft die kollektive Hoffnung seit Jahren zurück, während die individuelle Hoffnung diesen Verlust gemeinschaftlicher positiver Zukunftsbilder kompensiert: „Die Welt geht den Bach runter, aber mich wird das nicht betreffen.“ (https://www.unisg.ch/de/newsdetail/news/hoffnungsbarometer-2025-was-gibt-menschen-in-der-schweiz-zuversicht)
Hoffnung als Motivationsfaktor
Hoffnung ist jedoch so viel mehr als lediglich Veränderungen auszusitzen und Krisen auszuhalten. Hoffnung hat auch eine gestaltende Kraft. Laut Ernst Bloch (Das Prinzip Hoffnung) ist Hoffnung revolutionär, wenn sie Wege aufzeigt, wie eine bessere Zukunft aussehen kann. (https://www.youtube.com/watch?v=ls8AksUXSYI)
Entsprechend lässt sich festhalten:
- Hoffnung ohne Handlung wird zur Illusion.
- Handlung ohne Hoffnung ist zielloser Aktivismus, um des Aktivismus Willen.
Denn wofür sollte sich jemand einsetzen, wenn ohnehin alles verloren ist, es also keine Hoffnung mehr gibt?
Als reifere Version von Greta Thunberg lässt sich Luisa Neubauer anführen. Luisa Neubauer als Mitorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland tritt weniger
apokalyptisch und stärker vermittelnd auf und ist damit politisch anschlussfähiger. Für Neubauer ist Hoffnung zentral, um handlungsfähig zu bleiben. Sie entsteht, wenn Menschen handeln, um gemeinsam etwas zu erreichen. Hier wird Hoffnung nicht gegen Aktivismus ausgespielt, sondern durch Aktivismus durch Hoffnung und Hoffnung durch Aktivismus erzeugt. Gleichzeitig warnt sie vor einer verlogenen Hoffnung, die von politischen Eliten oder Medien verbreitet wird: „Wir können uns nicht mit Hoffnung zudecken, wenn wir keine Politik machen, die Hoffnung verdient.“
Hoffnung sollte stattdessen zu einem kollektiven Prozess werden. Neubauer spricht oft von „Hoffnung als Arbeit“ oder „Hoffnung als kollektiver Praxis“. Hoffnung ist kein Gefühl, sondern ein Ergebnis von Solidarität, Engagement und Wandel, die entsteht, wenn gemeinsam Strukturen verändert werden.
(Luisa Neubauer und Alexander Repenning: Vom Ende der Klimakrise, 2019)
Zentrale Einsichten aus dem Aktivismus-Diskurs für Unternehmen
I) Hoffnung ohne Handlung führt zu Resignation.
Hoffnung, die nicht mit konkretem Handeln verbunden ist, wird als vertröstend empfunden. Predigen In Organisationen Führungskräfte Optimismus, ohne dass sich strukturell etwas verändert, sind die Folgen davon Zynismus oder passiver Widerstand.
In diesem Sinne sollten Hoffnungen einen gemeinsamen Prozess anstoßen: „Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wir haben drei Initiativen gestartet, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
II) Hoffnung entsteht durch kollektives Handeln
Hoffnung entsteht durch ein gemeinsames erfolgreiches Tun. Wer erlebt, dass Veränderungen möglich sind, selbst wenn es nur kleine Schritte sind, glaubt (wieder) an sich selbst und eine bessere Zukunft.
III) Hoffnung braucht Ehrlichkeit
Hoffnungsvolle Utopien dürfen die Realität nicht beschönigen. Nur wenn der Ernst der Lage klar benannt wird, wirkt Hoffnung glaubwürdig: „Ja, es gibt Unsicherheiten – aber wir gehen sie gemeinsam an.“
Literatur:
 Michael Hübler
Michael Hübler