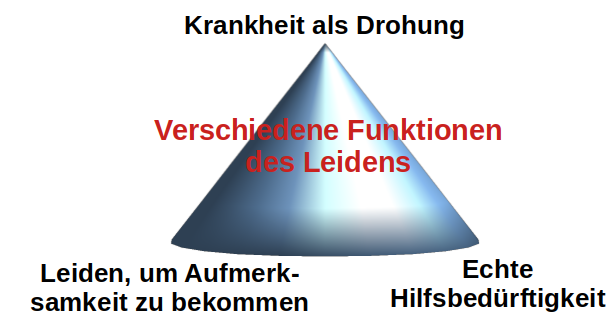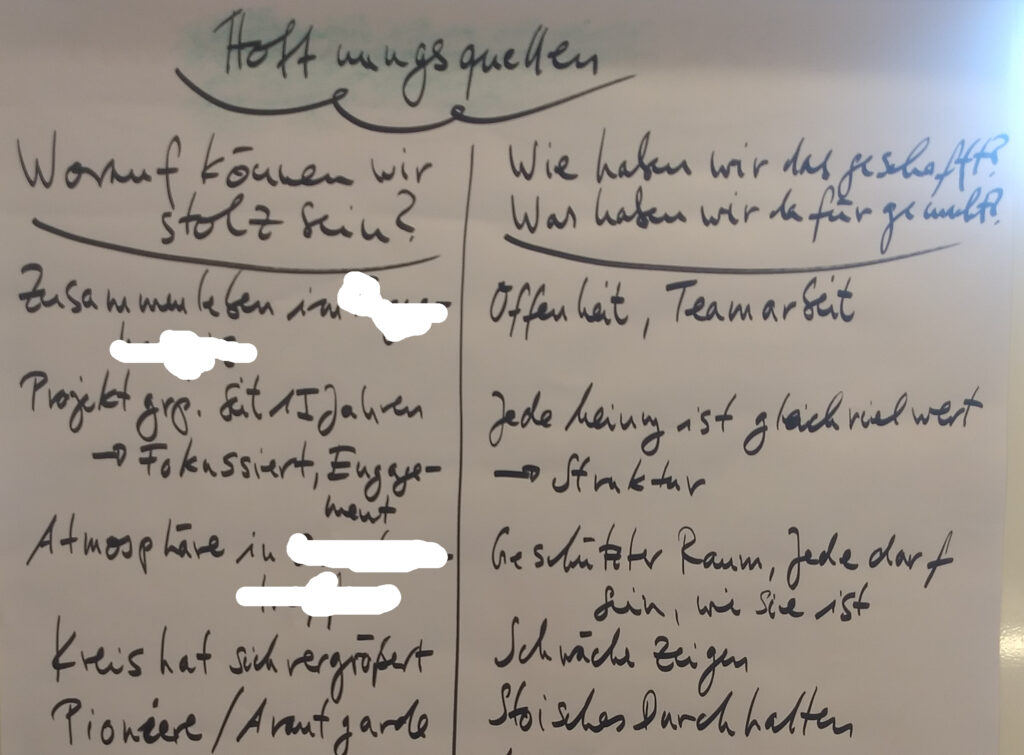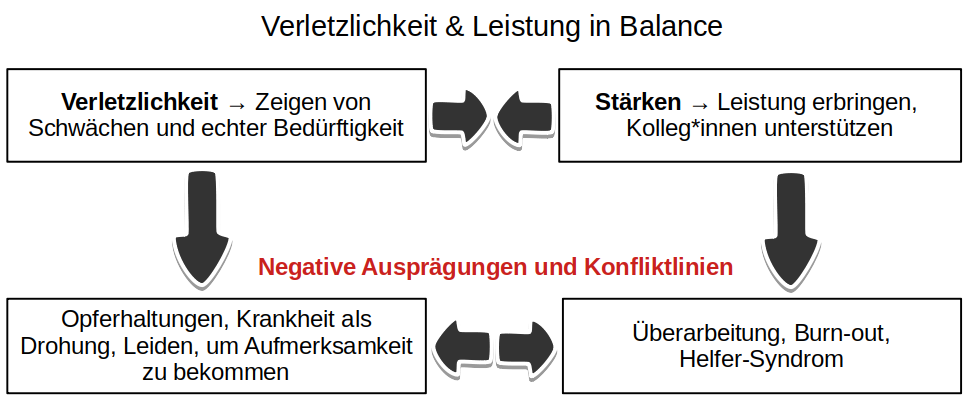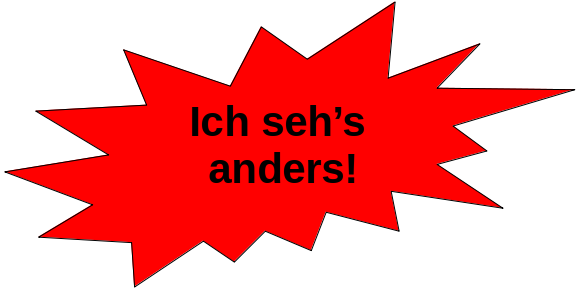René Girard, Silicon Valley und die Hassliebe mit uns selbst

Wir erklären digitale Plattformen gern mit Technik: Algorithmen, Daten, KI. Das ist bequem – nur leider falsch.
Was Social Media wirklich antreibt, ist kein Code, sondern eine uralte menschliche Dynamik, die der französische Anthropologe René Girard beschrieben hat: Mimetisches Begehren. Silicon Valley hat sie nicht erfunden, aber perfektioniert, skaliert und monetarisiert.
Wir begehren nicht autonom – wir imitieren
Girards zentrale These ist verstörend einfach:
Wir wollen Dinge nicht, weil sie gut sind oder wir ein tieferes Bedürfnis danach haben, sondern weil andere sie haben.
Bei Girard geht es v.a. um Status, Anerkennung und Aufmerksamkeit – eingebettet in die Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
Begehren ist nachahmend. Wir orientieren uns an Modellen, d.h. an Menschen, die uns ähnlich genug sind, um vergleichbar zu sein. Diese Modelle sind gleichzeitig Vorbild wie Rivale. Nicht Fremde lösen Rivalitäten aus, sondern Menschen, die uns vermeintlich nahe sind. In der Arbeit Kolleg*innen, bei Jugendlichen Peers oder im Internet Influencer, die vermeintlich wie wir sind. Darum funktionieren soziale Netzwerke so gut: Sie liefern uns endlos vergleichbare Modelle.
Silicon Valley als Girard-Maschine
Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder TikTok tun drei Dinge gleichzeitig:
- Sie machen Begehren sichtbar (Likes, Follower, Reichweite)
- Sie erzeugen Vergleichbarkeit (gleiche Formate, gleiche Codes)
- Sie verschärfen Rivalität (Ranking, Performance, Aufmerksamkeit)
Das Objekt (Artikel, Jobtitel, Produkt) ist zweitrangig. Entscheidend ist die Anerkennung als Signal von Zugehörigkeit.
Silicon Valley monetarisiert keine Inhalte, sondern unsere Angst, irrelevant zu sein.
Authentizität = Nähe ohne Kontext
Besonders perfide ist dabei der Kult der „Authentizität“. Authentisch sein bedeutet online in den Augen vieler, emotional offen, verletzlich oder „ganz normal“ zu sein. Kurze authentische Wackelvideos in Alltagskleidung kommen oft besser an als professionelle Hochglanzvideos in Businessklamotten. Das erzeugt Nähe: „Der Typ da ist wie ich.“ Allerdings ist die Nähe simuliert. Es fehlt der Klassenkontext, es fehlen Werdegänge oder Hintergründe. Wir fühlen uns jemandem nah, den wir nie treffen, nie prüfen, nie wirklich kennen werden.
Girard würde sagen: Authentizität ist mimetische Gleichmacherei, die Begehren verstärkt, ohne Verantwortung zu erzeugen.
Wut entsteht nicht aus Fremdheit, sondern aus Ähnlichkeit
Warum eskalieren Konflikte gerade in homogenen Gruppen?
Girard widerspricht dem naiven Bild von Konflikten aufgrund von Unterschiedlichkeiten.
In Wahrheit gilt oft: Je ähnlicher, je vergleichbarer und je näher, desto explosiver.
Anders formuliert: Warum sollte ich auf jemanden neidisch sein, der bislang ein ganz anderes Leben führte als ich? Warum sollte ich mich mit jemandem vergleichen, der andere Startbedingungen hatte, mit mehr finanziellen Ressourcen und auf ein super Netzwerk der Eltern zurückgreifen kann?
Also tauschen wir uns viel mehr unter Gleichen aus und blicken viel seltener über unseren Tellerrand. Und dann heißt es: Willkommen in der Filterblase! Doch weil damit äußere „Gegner“ verschwinden, werden kleine Abweichungen nach und nach hochgejazzt, was wiederum laut Girard zu einer Suche nach internen Sündenböcken führt.
Wut richtet sich daher nicht direkt auf Fremde, sondern auf fast Gleiche, die die eigene Austauschbarkeit sichtbar machen. Der Sündenbock dient lediglich der Triebabfuhr.
Mimetisches Begehren im Unternehmen
Diese Dynamik wirkt auch mitten im Arbeitsalltag. Und damit sind wir mitten in meinem mediativen Alltag:
Beispiel 1: Die High Performerin
Ein Team bewundert eine Kollegin:
- Sie wird von ganz oben gesehen,
- bekommt Lob und Auszeichnungen vom Management,
- ist aufgrund ihrer exzellenten Arbeit bei Kunden beliebt
- und darf sich regelmäßig spannenden Projekten widmen.
Kurzum, und das sagen – zumindest zu Beginn – alle: Sie hat es sich verdient und ist ein Vorbild für alle. Und das Management wird nicht müde, dies immer wieder öffentlich zu betonen.
Akt 1: Die Nachahmung beginnt: „Wow! Was für ein Vorbild! Da will ich auch hin.“
Akt 2: Sie wird Konkurrentin gesehen: „Ihr Vorsprung ist enorm.“
Akt 3: Sie wird nach und nach subtil abgewertet: „Ob da auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht? Vielleicht hat sie ja was mit dem Chef? Ob so eine Leistung ohne Drogen überhaupt möglich ist? Die macht doch mehr Selbstmarketing als Performance. Die spielt uns beim Kunden aus. Mal ehrlich: So gut ist das auch nicht.“
Innerhalb kurzer Zeit wird das Modell zur Rivalin.
Beispiel 2: Werte-Konflikte
Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Triggerwarnung: Es könnte ein wenig ketzerisch werden. Aber was passiert, wenn Unternehmen mit Wertekatalogen arbeiten, Diversity, Respekt, Toleranz und Augenhöhe predigen?
Sollen alle dieselben Werte teilen:
- wird Abweichung gefährlich
- wird Moral zur Statusfrage
- entstehen interne Polarisierungen
Um nicht falsch verstanden zu werden: Werte sind wichtig zur Stabilisierung eines Unternehmens insbesondere in turbulenten Zeiten nach innen (Mitarbeiter*innen) und außen (Bewerber*innen, Kund*innen). Jedoch kann man es …
- übertreiben, wenn bereits kleine Abweichungen moralisch nicht erlaubt sind und
- Werte dogmatisch verordnen, ohne einen gemeinsamen Prozess zu durchlaufen, der möglichst viele im Unternehmen einbezieht.
Wenn das passiert, drehen sich Konflikte nicht um Inhalte, sondern um Zugehörigkeit.
Beispiel 3: Innovationsneid
Auch Konflikte in Teams lassen sich mit Girard erklären. Teams arbeiten an ähnlichen Themen unter gleichen Bedingungen, mit gleichen oder ähnlichen Zielen, aber einer begrenzten Anerkennung. Nicht der Erfolg eines Kollegen an sich ist das Problem, sondern dass er im selben Umfeld zu denselben Bedingungen stattfindet. Es könnte nun die Suche danach losgehen, was dieser Kollege anders macht. Was als Ansporn auch oft passiert. Gleichzeitig wird aber auch danach geforscht, warum der Erfolg des Kollegen unverdient ist.
Natürlich greift Girards These für Konflikte zu kurz, um sie allumfassend zu erklären. Sie liefert jedoch einen weiteren strukturellen Ansatz, um sie zu verstehen. Lösungen zum Ausgleich solcher Konflikte bietet Girard nicht an. Doch bereits die Kenntnis um das Prinzip von Modell-Rivalen könnte Spannung aus Konflikten nehmen.
Girard als düsterer Bruder von Bandura
Der Psychologe Albert Bandura zeigte in seinem bekannten „Lernen am Modell“, dass wir am meisten von ähnlichen Modellen lernen. Bandura sah dies jedoch vor allem positiv: Wir imitieren andere, die uns ähnlich sind und lernen daraus. Dies verschaffte der Menschheit einen stetigen Fortschritt, zumal Erklärungen nicht immer einfach sind. Einfacher ist es, wenn der Meister zu seinem Lehrling sagt: „Schau mal wie ich mit dem Hammer hier drauf schlage und mach es genau so nach.“
Girard ergänzt, dass genau dort gleichzeitig der Konflikt beginnt, weil das Lern-Modell von Beginn an ein Rivale ist. Girard wird damit zum dunklenBruder der Lerntheorie.
Reckwitz und die innere Hassliebe
Der Soziologe Andreas Reckwitz liefert ein weiteres, spannendes Puzzleteil zum Verständnis heutiger sozialer Zusammenhänge: (Post-) Moderne Subjekte wollen einerseits dazugehören (Standardisierung) und müssen andererseits einzigartig sein (Singularisierung). Im Digitalen bedeutet das: Sei wie alle, aber gleichzeitig besonders. Kein Wunder, dass uns die Digitalisierung verrückt macht.
Wir leben daher – ergänzt mit Girard – mit einer stetigen inneren Spannung: Ich imitiere, um dazu zu gehören, will aber auch einzigartig sein und verachte meine eigene Austauschbarkeit, weil meine Einzigartigkeit in einem strengen Rahmen stattfinden darf.
Die Hassliebe bezieht sich damit nicht nur auf andere Modell-Rivalen, sondern ist ein Teil unseres modernen Selbst.
Imitieren: Ja, aber richtig!
Girard schärft unseren Blick auf Konflikte:
- Rolle der Vergleiche: Der Mensch ist im Grunde genügsam und entwickelt erst durch Vergleiche bestimmte Bedürfnisse und damit auch Neidgefühle.
- Rolle des Kontextes: Ohne Kontext fokussieren wir uns oft auf Statusfragen. Mit Kontext sind diese meist nichtig.
- Rolle der Struktur: Konflikte und Eskalationen sind nicht nur individueller Natur, sondern oft struktureller als wir denken.
Was in der realen Welt passiert, wird digital noch wesentlich mehr verschärft, wenn wir die Dynamiken dahinter nicht reflektieren. Tun wir es, hat dies weitreichende positive Konsequenzen für unsere Gesundheit und Beziehungen:
Wer diese Zusammenhänge erkennt, blickt entspannter auf die 1000 Likes eines Kollegen oder den Erfolg von High Performern. Gleichzeitig lassen sich Konfliktdynamiken leichter durchschauen und durchbrechen.
Wir sind weder Opfer solcher Dynamiken, noch von Algorithmen. Wir sind Komplizen unserer eigenen mimetischen Natur: Modelle spornen uns an, uns persönlich weiter zu entwickeln, kippen jedoch ab einem bestimmten Punkt in Rivalität um.
Das Silicon Valley verkauft uns Verbindungen und Vernetzungen, lebt jedoch davon, dass wir uns ständig vergleichen, am liebsten negativ, was algorithmisch am meisten verstärkt wird. Dass dahinter eine Agenda steht, lässt sich zumindest vermuten, wenn wir weitere Einflüsse wie Amy Rand oder Curtis Yarvin analysieren.1
 Michael Hübler
Michael Hübler