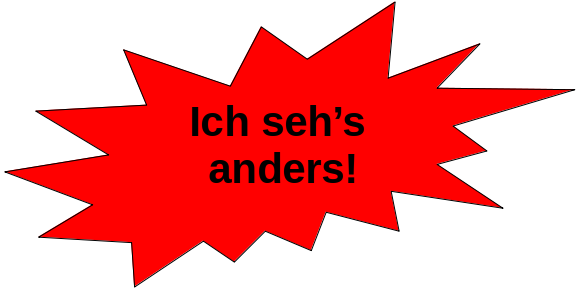1. Gemeinschaft und Ausstoß (ca. 10.000 v. Chr. – 1.000 v. Chr.)
In frühen Jäger- und Sammlergruppen war das Zusammenleben überlebenswichtig. Wer gegen soziale Normen durch Diebstahl, Gewalt oder Verrat verstieß, wurde oft ausgestoßen oder geächtet.
2. Das Prinzip der Ehre und Duelle (ca. 1.500 – 1.800 n. Chr.)
In der europäischen Frühneuzeit wurden persönliche Konflikte v.a. in der Hochkultur schnell zur Frage der Ehre, die mit Hilfe eines Duells wieder hergestellt werden sollte. In Frankreich wurden Duelle zwar 1626 offiziell verboten. Dennoch fiel noch 1829 der russische Dichter Alexander Puschkin einem Duell zum Opfer.
3. Vernunft und Verhandlung (18. – 20. Jahrhundert)
Mit der Aufklärung verschoben sich gewaltvolle Konfliktlösungen hin zu Verhandlungen und juristischer Klärung. Gerichte und Schiedsverfahren förderten die Gleichberechtigung in Streitfragen. Im Alltag entstanden parallel dazu bürgerliche Tugenden wie Toleranz und Zivilität. Produktiv zu streiten wurde zu einem zivilisatorischen Lernprozess.
4. Öffentliche Bühne und Medien (20. Jahrhundert)
Mit Presse, Radio und Fernsehen wurden Konflikte zunehmend Teil einer öffentlichen Inszenierung. Moralische Streitigkeiten fanden ihren Weg von privaten Haushalten und Straße in Talkshows. Skandale von Personen öffentlichen Interesses wurden medial genüsslich ausgebreitet, inklusive öffentlicher Statements, Entschuldigungen, Abgrenzung und Empörung gegenüber den betreffen Personen.
5. Digitale Ächtung und Cancel Culture (21. Jahrhundert)
Seit den 2010er-Jahren dezentralisierte die Digitalisierung die soziale Ächtung:
- Im Internet treten Nutzer*innen sowohl als Konsument*innen als auch als Produzent*innen auf. Damit werden nicht nur Konflikte von Personen öffentlichen Interesses kommuniziert, sondern von jedem und jeder.
- Digitale Medien ermöglichen eine kollektive Konfliktbewertung in Echtzeit. Das Internet bietet eine riesige Bühne als Konfliktverstärker, auf der nicht nur Beteiligte, sondern auch Unbeteiligte ihre Meinung äußern können.
- Begriffe wie „Cancel Culture“ (ab ca. 2017) beschreiben moderne Formen einer digitalen Sanktionierung. Der soziale Ausschluss von früher verlagerte sich ins Virtuelle, mit teilweise ebenso existenziellen Folgen. Wie der Philosoph Robert Pfaller sagt: Wir leben nicht mehr ausschließlich in einer Leistungsgesellschaft, sondern auch wieder in einer Schamgesellschaft. Ehre erscheint heute wieder wichtiger als während der Aufklärung.
6. Vom Canceln zur Resonanz – Ein Blick in die Zukunft
Wie könnte es weitergehen? Finden wir zu einem neuen aufgeklärten Umgang mit Konflikten zurück? Oder weitet sich das gegenseitige Canceln aus und die Gesellschaft zersplittert sich in kleine Stämme, die nicht mehr miteinander sprechen?
Empathische Vernunft
Anstatt einer rein rationalen Neuauflage der Aufklärung könnte eine andere Form von Vernunft entstehen:
- Im Zeitalter von Fakenews und Wissensschaftskritik reicht es nicht mehr aus, sich lediglich auf Argumente zu konzentrieren.
- Die kommende Vernunft sollte stattdessen empathische Züge annehmen: Widerspruch muss keine Ablehnung oder gar Ausschluss bedeuten, sondern kann ein anderer Teil von Beziehung sein.
- Künstliche Intelligenz und Datenethik könnten (und sollten) uns dabei helfen, kollektive Empörungen zu kontextualisieren: „Diese Aussage stammt aus 2020, am Anfang der Corona-Pandemie, als noch wenige Informationen über das Virus vorhanden waren.“
Auswählen statt Canceln
Im Internet treffen sich verschiedene soziale Blasen, die bislang in den analogen Stammtischen getrennt waren. Dadurch entstehen Konflikte, die früher nicht entstanden bzw. über Parteien kanalisiert wurden:
- In einer überfordernden Informationswelt werden Menschen langfristig lernen müssen, nicht mehr zu allem Stellung zu beziehen, sondern bewusster auszuwählen.
- Da die digitale Welt nicht vergisst, muss zudem niemand sofort auf eine Äußerung reagieren. Stattdessen fassen K.I.-gesteuerte Plattformen die soziale Reputation einer Person langfristig zusammen. Was auf den ersten Blick bedrohlich wirkt, kann auf den zweiten Blick als Regulator fungieren, um Diskussionen zu befrieden und eine neue Zivilität herzustellen.
- Anstatt zu Canceln gilt es folglich, wieder ein Mindestmaß an ziviler Kinderstube, basierend auf Toleranz und Respekt herzustellen.
- Plattformen können zusätzlich Feedbackräume schaffen, die mehr auf Reparatur als auf Strafe setzen, indem sie digitale Mediationsräume anbieten oder KI-gestützte Deeskalationen einsetzen.
Retro-Stämme, Zersplitterungen und Neu-Gruppierungen
Wenn wir an X denken oder allgemein die gesellschaftliche Entwicklung in den USA, zeigt sich bereits der Ansatz von Retro-Stämmen in der Gesellschaft:
- Meinungsgruppen ziehen sich in digitale Stämme mit gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Sprache zurück, wodurch in einem Zwischenschritt Parallelgesellschaften mit je eigener Moral entstehen.
- Weil der Mensch jedoch nicht nur eine Sehnsucht nach Gruppenzugehörigkeit hat, sondern auch zu Abgrenzung neigt, verlagern sich Konfliktgespräche in die Retro-Stämme, wodurch es innerhalb eigentlich einheitlicher Meinungs-Gruppen zu weiteren Unterteilungen kommt.
- Wenn externe Feindbilder nicht aufrecht erhalten bleiben, bietet diese zunehmende Zersplitterung der Stämme die Chance auf neue Begegnungen außerhalb der eigenen Meinungsblase.
Langfristige Utopie: Die „Resonanzgesellschaft“ (nach Hartmut Rosa)
Betrachten wir die menschliche Geschichte, liegt es nahe, Konflikte als zentrales Element des sozialen Zusammenlebens zu betrachten. Es gibt immer etwas zu verhandeln, sei es über materielle Güter, die Zukunft der Welt, den eigenen Status, soziale Aufmerksamkeit oder moralische Vorstellungen. Es stellt sich also weniger die Frage, wie viele Konflikte wir in der Zukunft haben werden, sondern vielmehr, wie wir Konflikte in unser Leben integrieren. Gemäß der Resonanztheorie nach Hartmut Rosa lassen sich Konflikte nicht nur als Angriff, sondern auch als Möglichkeit begreifen, gegenseitig an Widerspruch zu wachsen, was sich bereits bei Nietzsche oder Hannah Arendt nachlesen lässt:
- Konflikte bieten damit immer auch das Potenzial, über die eigenen Positionen und Meinungen nachzudenken und sich weiterzuentwickeln.
- Konflikte symbolisieren entsprechend eine besondere Form der Verbindung zwischen zwei Menschen oder Gruppen. Manche Gruppen wie Arbeitgeber vs. Arbeitnehmer, Christen vs. Moslems, Rechte vs. Linke usw., definieren sich förmlich über die Abgrenzung zu ihrem Gegenüber, weshalb der Politikwissenschaftler Ralf Langejürgen empfiehlt, sich in Konflikte zuerst zu entfaszinieren, bevor eine neue positiv aufeinander bezogene Beziehung wieder möglich ist.
Wer bislang glaubte, dass alles immer schlimmer wird:
- Es ist noch nicht so lange her, dass wir uns aufgrund unserer Ehre duellierten.
- Wenn sich auf Plattformen wie X nur noch einheitliche Meinungsträger*innen treffen, könnte dies schnell langweilig werden, wodurch Konflikte entstehen, die zu Zersplitterungen führen.
- KI muss nicht unser Feind sein, sondern kann Informationen kontextualisieren, um Aussagen ins richtige Licht zu rücken.
- Eine neue KI-Reputation, die sich freilich auch kritisch betrachten lässt, könnte zu einer neuen Zivilität führen.
- Sinnloser Streit macht irgendwann einmal müde, weshalb eine gezielte Auswahl von Stellungnahmen mittelfristig unumgänglich erscheint.
In diesem Sinne: Es wird nicht alles gut, sondern (wie immer) anders.
 Michael Hübler
Michael Hübler