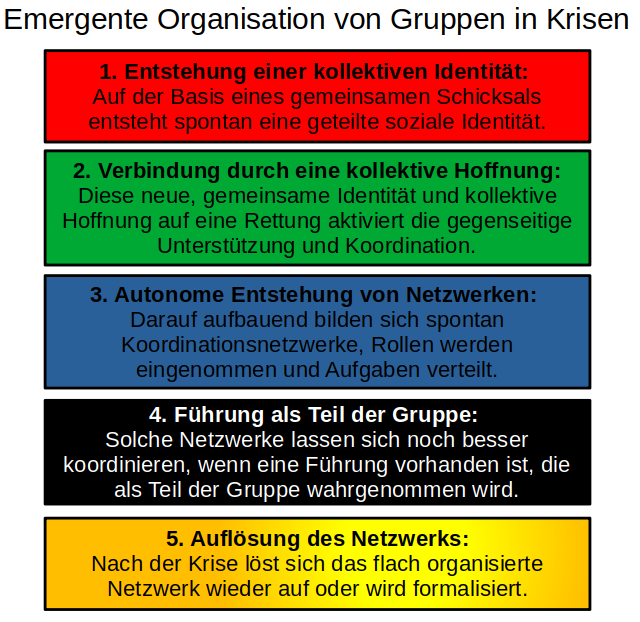Die Gesellschaft der Moderne ist auf Aufstieg ausgerichtet. Der Mensch strengt sich an, kann sich etwas leisten, bildet sich weiter, wird eine Führungskraft und macht Karriere. Das Aufstiegsversprechen sorgte jahrzehntelang für eine hierarchische Klarheit und Motivation in Unternehmen.
Doch was passiert, wenn einerseits dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert und andererseits junge Menschen kein Interesse mehr an diesem klassischen Aufstiegsmodell haben?
Manifest eines neuen Aufstiegsversprechens
I. Das Ende der neoliberalen Erzählung
Über Generationen galt: Wer sich anstrengt, wird belohnt. Bildung, Fleiß und Disziplin galten als Schlüssel zum Aufstieg. Doch dieses Versprechen ist gebrochen. Nicht, weil Menschen faul geworden wären, sondern weil die Strukturen erstarrt sind. Wer oben ist, bleibt oben. Wer unten anfängt, arbeitet oft sein Leben lang gegen unsichtbare Wände.
Erbe und Herkunft zählen mehr als Einsatz und Anstrengung. Die alte Erzählung von der Leistungsgesellschaft hat damit ihre Glaubwürdigkeit verloren.
Früher war Bildung der Schlüssel, um soziale Grenzen zu durchbrechen. Heute reproduziert sie bestehende Unterschiede. Eine Freundin meiner älteren Tochter studiert in Köln. Dort hieß es: „Das Studium ist ein Vollzeitstudium. Wer meint, er könne nebenher arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren, kann sich das abschminken. Sinnvoller ist es, zuhause bei seinen Eltern um mehr Geld zu bitten.“
Auch die Diskussion über den Sinn in der Arbeit, neudeutsch purpose, ist für viele mittlerweile eine schale Angelegenheit. In einer Gesellschaft, die Erfolg in Zahlen ausdrückt – Einkommen, Eigentum und Status – wirkt das Wedeln mit dem Sinn schnell wie ein Trostpflaster dafür, dass ein Unternehmen nicht mehr zu bieten hat.
II. Die Leere im postoptimistischen Zeitalter
Wo kein Aufstieg mehr möglich ist, entsteht Resignation. Wer nicht aufsteigen kann, grenzt sich wenigstens nach unten ab. Und wer auch darin scheitert, greift nach der Zerstörung – aus Wut, Ohnmacht oder dem Gefühl, überflüssig zu sein. Symptomatisch dafür sind Aussagen wie „Eigentlich bin ich kein Fan der AfD, aber ich will, dass die da oben einen Denkzettel bekommen“. Auf der anderen Seite gehen viele junge Menschen unter 25 nicht mehr zu Wahlen (siehe Brexit, Trump oder Bundestagswahlen → Studien der WZB, Friedrich-Ebert-Stiftung oder Bundeszentrale für politische Bildung).
Ein ähnliches Pendeln zwischen Resignation, Wut und Egoismus finden wie in Unternehmen wieder, wenn scheinbar ohne Grund sinnvolle Aufgaben abgelehnt oder Veränderungen blockiert werden.
Erscheint jedoch der Aufstieg als Karriere nicht mehr möglich, fällt auch ein wichtiger Motivator in der Arbeit weg: „Warum sollte ich mich anstrengen, wenn es ohnehin nichts bringt? Dann reicht es auch, das Nötigste zu tun und ansonsten mein Leben zu genießen?“
Dies betrifft vor allem die neue Mittelschicht, die sich im Gegensatz zur alten Mittelschicht weniger auf Materielles verlassen kann (Stichworte: Hausbesitz, Handwerk), sondern in einer Sharing-Community groß wurde und sich mit kreativen und digitalen Tätigkeiten einen höheren Status erarbeitete (→ Andreas Reckwitz: Gesellschaft der Singularitäten). Dieser Status besitzt jedoch wenig Fundament und kann schnell schwinden, bspw. wenn eine KI den eigenen Job übernimmt. Kein Wunder, dass aktuell ein enormer Druck im Kessel ist:
- Die Oberschicht grenzt sich ab.
- Die alte Mittelschicht schlägt zurück, bspw. durch horrende Handwerker-Rechnungen.
- Die neue Mittelschicht hat Angst vor dem Absturz.
- Die Unterschicht kämpft um ihr Überleben.
- Und viele junge Menschen weigern sich, Teil eines solchen toxischen Systems zu werden.
III. Ein neues Aufstiegsversprechen
Soll ein neues Aufstiegsversprechen wieder zu mehr Motivation in Unternehmen führen, darf es nicht mehr individuell und exklusiv sein, im Sinne von: „Ich will höher hinaus als du.“ Sondern kollektiv und inklusiv: „Wir wollen gemeinsam besser leben und zusammenarbeiten.“
Aufstieg sollte kein Wettlauf mehr sein, sondern ein Projekt kollektiver Gerechtigkeit, Sicherheit, Solidarität, Zufriedenheit, Autonomie, Sicherheit und Würde.
Tatsächlich zeigen Umfragen, dass junge Menschen v.a. deshalb nicht zu Wahlen gehen, weil sie weniger in Parteiprogrammen, sondern themenorientiert denken:
- Klima ist wichtig, aber die Grünen sind zu elitär.
- Solidarität ist wichtig, aber die SPD hängt noch zu sehr in der Vergangenheit und die Linke ist zu wenig liberal.
- Autonomie ist wichtig, aber die FDP agiert lediglich wirtschaftsliberal.
Übertragen wir diese Erkenntnisse auf Unternehmen, bedeutet ein postmoderner Aufstieg:
- dass niemand Angst vor einem gesellschaftlichen Absturz haben muss,
- dass Bildung und Seminare kein Privileg sind, um Karriere zu machen, sondern eine Möglichkeit persönlicher Weiterentwicklung,
- dass Arbeit Anerkennung erfährt, egal ob sie im Büro, in der Pflege oder an einer Maschine geleistet wird,
- dass alternative Lebensläufe verstanden, respektiert und gefördert werden,
- dass sich Wohlstand und finanzielle Sicherheit in einer guten Balance zu Freizeitzeit, Gesundheit und Sinn befinden.
Dieser qualitative Aufstieg funktioniert weniger vertikal, sondern horizontal:
- Sinnvoll verbrachte (Arbeits-)Zeit,
- Bildung für alle (Interessierte),
- Gesundheit als zentraler Baustein,
- persönliche statt verordnete Sinnsuche,
- Gemeinschaft statt Abgrenzung,
- Teilhabe an Unternehmensentscheidungen, wo es möglich und sinnvoll erscheint.
Fazit: Eine Zeitenwende
Es erscheint einfach, sich über die Arbeitsmoral junger Menschen zu beklagen. Schwieriger ist es, zu erkennen, dass wir aktuell mitten in einer großen Zeitenwende stehen. Noch schwieriger ist es Strukturen in Unternehmen anzupassen, damit Motivation auch für diejenigen wieder möglich ist, die nicht vertikal aufsteigen wollen. Logischerweise braucht es hier hybride Lösungen, um nicht die Mitarbeiter*innen vor den Kopf zu stoßen, die mit dem Aufstiegsmodell der Moderne groß wurden. Ein erster wichtiger Schritt wäre es jedoch, zu akzeptieren dass junge Menschen anders arbeiten wollen.
 Michael Hübler
Michael Hübler