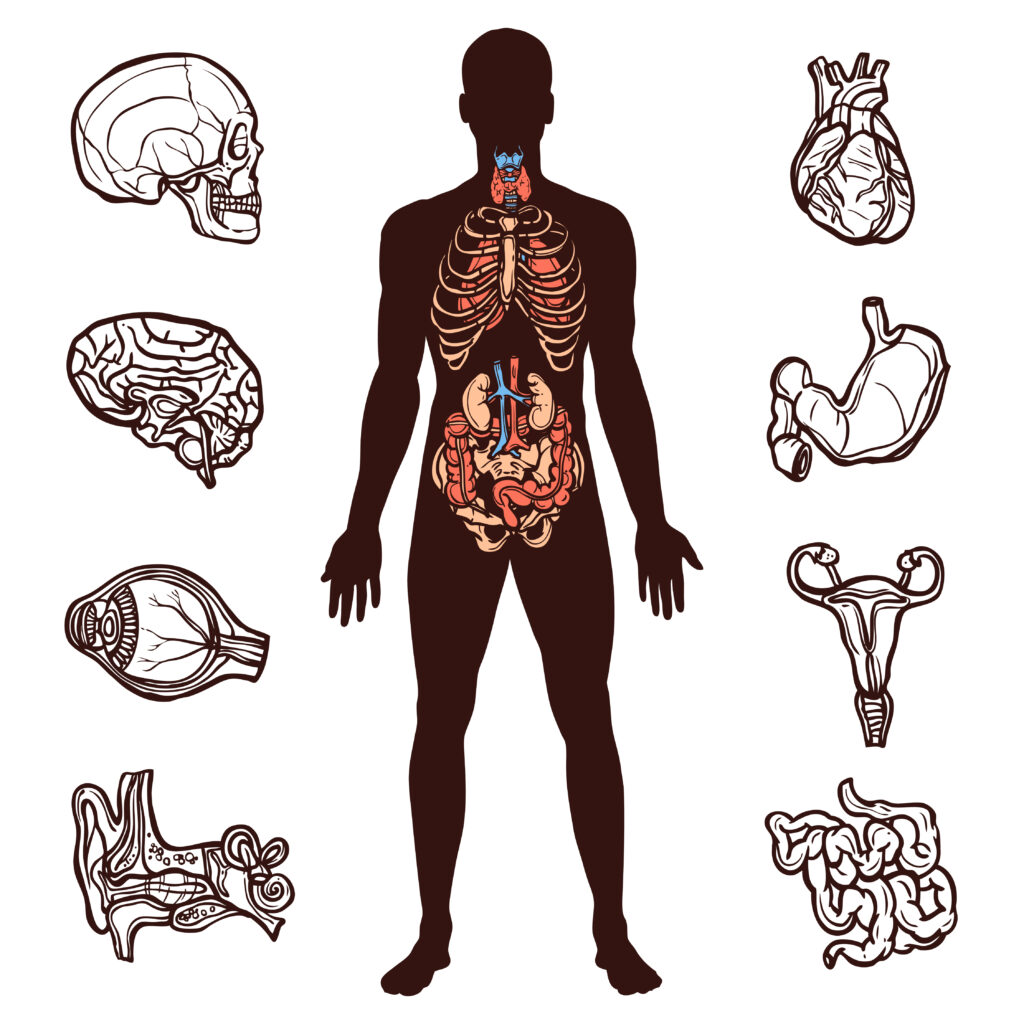Über das Improvisieren in Zeiten der Krise
Idealismus versus Materialismus
Wird unser Sein durch unser Bewusstsein bestimmt? Oder unser Bewusstsein durch unser Sein? Der Idealismus geht vom ersten aus. Der Materialismus vom zweiten – mit weitreichenden Konsequenzen für unsere Sicht auf die Welt, unsere Verbissenheit im Umgang mit Zielen, unsere Moralvorstellungen und unseren Umgang mit Stress.
Grundsätzlich würden vermutlich die meisten Menschen eine idealistische Sichtweise bevorzugen. Warum soll ich mich in mein Schicksal ergeben, wenn ich von einer besseren Welt oder einem eigenen, besseren Leben träumen kann? Wir wollen doch die Welt retten. Oder zumindest den Klimawandel verzögern. Oder nicht?
Tragisches versus lustvolles Scheitern
Dabei liegt gerade das idealistische Träumen nahe an der Tragödie. Die Tragödie suggeriert dem Menschen, dass etwas idealisiert Großartiges niemals Erfolg haben kann. Held*innen versuchen es dennoch und scheitern. Die wahre Freiheit kann für Idealisten daher nur in der Zukunft stattfinden. Die Welt, in der wir leben ist unvollkommen und muss verbessert werden. Der Mensch muss erzogen oder zumindest entwickelt werden. Daher ist bei idealistischen Menschen auch die Moral niemals weit weg. Für die Durchsetzung der Moral wird gekämpft und werden Kriege geführt, ähnlich den religiösen Kreuzzügen im Mittelalter oder dem modernen Dschihad, dem heiligen, islamischen Krieg.
Wenn wir es jedoch nicht schaffen, dass eine neue Welt entsteht – was aufgrund der Ferne zu den realen Verhältnissen zumindest teilweise immer scheitern muss – entstehen Schuldgefühle, weil wir uns nicht genug angestrengt haben. Deshalb haftet Idealisten immer auch etwas Verkrampftes, Verbissenes, Humorloses und Lustfeindliches an. Dürfen sie es sich überhaupt erlauben, Spaß in einer Welt zu haben, die aus ihrer Sicht dem Untergang geweiht sind? Wäre das nicht ein Frevel?
Eine idealistische Sichtweise auf das Leben muss auch im Einzelfall scheitern, weil es unmöglich ist, dem neoliberalen Mantra der totalen Gleichheit zu folgen. Weil wir über unterschiedliche Startbedingungen verfügen, ist es zwar aus Gleichberechtigungsgründen ethisch richtig, Randgruppen mehr zu ermöglichen als früher. Dennoch kann nicht jede*r alles werden. Diese Rahmenbedingungen erkennt der Materialismus an, wenn er davon ausgeht, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt.
Würde der Mensch sich nun lediglich als Realist in die realen Verhältnisse seines Lebens ergeben, wären die bestehenden Verhältnisse für alle Zeiten zementiert. Der Materialist im Sinne des österreichischen Philosophen Robert Pfallers (Wofür es sich zu leben lohnt) erkennt diese Umstände an und beginnt jedoch anstatt einer bloßen Akzeptanz mit ihnen zu spielen. Damit ist er der Komödie näher als der Tragödie. Er ist kein Held, der einen idealen Zustand anstrebt, sondern begibt sich lust- und humorvoll in die Rolle des einfachen Menschen. Mit großformatigen Helden können wir uns nur identifizieren, wenn wir auch im realen Leben weit über uns hinauswachsen. Andernfalls entlassen sie uns frustriert zurück in unser einfaches Leben. Mit einem Clown, der auf einer Bananenschale ausrutscht, identifizieren wir uns (vermutlich) alle, weil wir alle Situationen eines zufälligen Scheiterns kennen.
In Komödien geht es um das kleine Scheitern im Alltag auf der Basis kleiner Katastrophen und Missverständnisse, während in Tragödien das große Scheitern angesagt ist. Dies wird besonders deutlich in Verwechslungskomödien wie beispielsweise in Charlie Chaplins „Der große Diktator“, wo ein einfacher Friseur aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Diktator Hinkel verwechselt wird. Der Friseur hat keinen idealistischen Plan zur Verbesserung der Welt, sondern wird mit einem manifesten, materialistischen Fakt konfrontiert. Fortan muss er auf diese aufgezwungene Rolle reagieren, was zu einigen paradoxen Situationen führt. Er wird nicht zu einem authentischen Helden, der einer eigenen Agenda folgt, sondern zu einem Helden wider Willen. Diese komödiantischen Verwicklungen und erzwungenen Improvisationen liegen unserem eigenen Alltag wesentlich näher als ein Idealismus mit epischen Zielen zur Rettung der Welt.
Während also die wahre Freiheit und das wahre Glück für Idealisten niemals stattfindet, weil wir uns in Gedanken immer eine bessere und schönere Welt vorstellen können, gibt sich der Materialist nicht mit der Welt ab – das würde ein Realist tun – sondern begibt sich wie im Improvisationstheater in eine Rolle, in der er humor- und lustvoll mit dem spielt, was er vorfindet. Er sucht sich folglich eine Nische, in der er ein gutes Leben führen kann, und vielleicht gerade aufgrund der Ferne einer idealistischen Verbissenheit die Welt zu einem besseren Ort macht.
Improvisieren in Krisenzeiten
Was folgt nun aus all dem? Ein idealistisches Bild von der Welt ist sicherlich hilfreich, um bestehende Umstände zu verbessern. In Zeiten von Krisen können sich viele Menschen ein solches Bild jedoch nicht mehr vorstellen, weil sich die Bilder von einer besseren Zukunft, die ihnen bis dato präsentiert wurden, als unerreichbar herausstellten.
In solchen Fällen ist es sinnvoller, die Umstände materialistisch anzuerkennen und zu lernen, damit zu spielen. Ein Spiel wiederum erfordert klare Rollen und Regeln. Das einfachste Rollensystem im Improtheater besteht im Unterschied zwischen einem Hoch- und einem Tiefstatus. Der Realist würde nun die damit verbundenen Machtverhältnisse anerkennen. Der Materialist erkennt lediglich an, dass es Unterschiede im Status gibt, was jedoch nicht bedeutet, dass ein Mensch im Tiefstatus automatisch unterlegen sein muss. Bereits Hegel wusste: Meister und Untergebene sind voneinander abhängig. Denn was wäre ein Meister, wenn der Untergebene das „Spiel“ nicht mehr mitspielt oder die wunden Punkte des Meisters, beispielsweise seinen Stolz, manipuliert?
Die einfachste Regel im Improtheater lautet „Alles annehmen. Niemals Nein sagen“. Das wieder bedeutet nicht, dass wir alles auf alle Zeiten akzeptieren müssen. Stattdessen können wir mit dem Gegebenen experimentieren, anstatt bloß von einer idealen Zukunft zu träumen und so zu Lösungen kommen, die nicht einmal in unseren kühnsten, idealistischen Träumen auftauchten.

 Michael Hübler
Michael Hübler